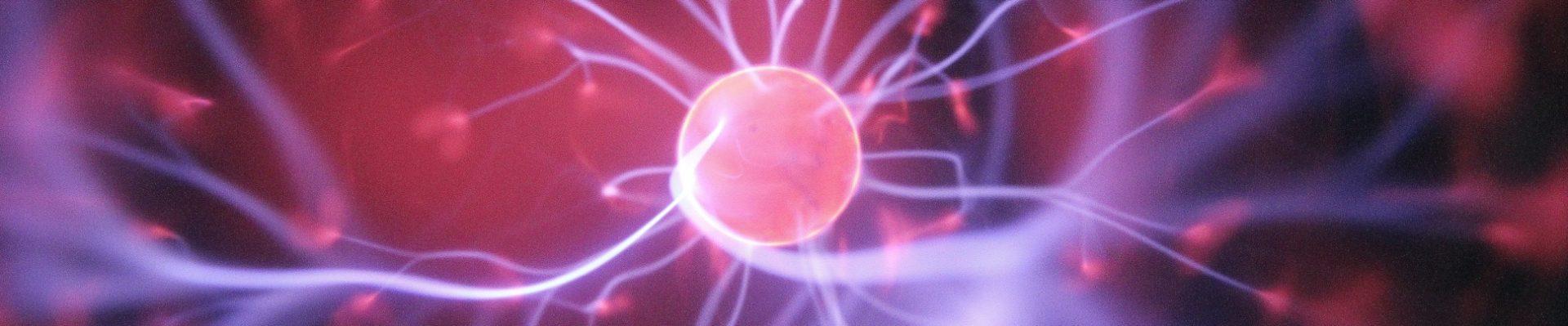Teilen:
02.05.2025 08:50
„Faschismus ist eine Ideologie der Tat“
Faschismus sei keine Schablone, sondern eine Ideologie der Tat, betont der Historiker Dr. Daniel Hedinger von der Universität Leipzig. Im Interview warnt er, dass Donald Trumps zweite Amtszeit genau durch solche radikalen Grenzüberschreitungen den Weg in ein faschistisches System ebnen könnte. Er erläutert, wie schon in den 1930er Jahren imperiale Expansion und gegenseitige Radikalisierung die damalige Weltordnung zerrissen, und er warnt: Die Anerkennung der Krim-Annexion wäre ein historischer Tabubruch, der an die fatalen Irrtümer der Appeasement-Politik erinnert. Ein Gespräch über globale Dynamiken des Faschismus und historische Lehren.
Herr Dr. Hedinger, ist Donald Trump ein Faschist?
Diese Frage steht schon seit der ersten Präsidentschaft Trumps im Raum, doch die Eindeutigkeit, die sie einfordert, ist problematisch. Denn sie überblendet einen entscheidenden Charakterzug des Faschismus: Seinen Aufstieg verdankt er stets einem längeren Prozess, der von Radikalisierungsschüben gekennzeichnet wird. Darum andersherum: Wenn wir mit letzter Sicherheit sagen können, dass ein Politiker ein Faschist ist, ist es schon viel zu spät – die männliche Form ist hier übrigens bewusst gewählt, denn die Geschichte ist bemerkenswert arm an faschistischen Führerinnen oder gar Diktatorinnen.
Faschismus basiert auf einer revolutionären Ideologie, die auf die Wiedergeburt einzelner Nationen abzielt und bestehende soziale, kulturelle, wirtschaftliche und politische Ordnungen über den Haufen wirft. Die Debatte über das Phänomen hat sich jedoch insgesamt zu lange und zu viel mit Definitionsfragen beschäftigt, die dann in scheinbar eindeutige Antworten mündete, die wiederum jede weitere Diskussion unterband. Das Problem damit ist nur: Auch schon in einer pseudo-faschistischen Autokratie oder einer quasi-Diktatur lebt es sich, je nachdem welche Hautfarbe, Geschlecht oder Gesinnung man hat, nicht mehr so gut. Was wir zum jetzigen Zeitpunkt aber mit Sicherheit sagen können, ist, dass Faschismus seit einigen Jahren auf dem Vormarsch ist – und zwar weltweit. Dies wiederum hat sehr wohl viel mit Trump zu tun.
In Ihrem Buch „Die Achse“ zeigen Sie, dass Faschismus historisch ein transnationales Phänomen war, das sich gegenseitig radikalisierte und globale Dynamiken entfaltete. Wo sehen Sie Parallelen aber auch Unterschiede zum neuerlichen Aufstieg antiliberaler Bewegungen und zu der Dynamik, die einst die Achsenmächte Deutschland, Italien und Japan verband?
Die Weltordnung der Zwischenkriegszeit zerfiel, weil Japan, Italien und Deutschland sie im Zusammenspiel zerstörten. Dabei radikalisierten sich alle drei Länder wechselseitig und kumulativ. Häufig übersehen wird dabei aber, dass dieser Zerfall von den imperialen Peripherien in Ostasien und Afrika einsetzte – noch bevor er in der zweiten Hälfte der Dreißigerjahre Europa erreichte. In der Zwischenkriegszeit schöpfte faschistische Radikalisierung daher vor allem auch aus transimperialer Kooperation und Konkurrenz. Dadurch war der Faschismus schon damals kein rein europäisches, sondern ein globales Phänomen.
Mit direkten Parallelen sollte man vorsichtig sein. Doch in die Gegenwart übersetzt impliziert dies meiner Meinung nach zweierlei: Erstens sollten wir sehr genau auf derartige Prozesse der Radikalisierung achten, insbesondere wenn sie mit Grenzüberschreitungen verbunden sind. Von der Besetzung des Panamakanals oder Grönlands zu fabulieren, ist das eine, ein militärischer Einmarsch etwas anderes.
Zweiteres ist bisher nicht geschehen, und damit verbunden wäre meine zweite These: Der Fokus liegt momentan stark auf Trump und die Faschisierung der USA. Aber wahrscheinlich ist das mitnichten unser größtes Problem, auch wenn das medial jetzt gerade so rüberkommt. Denn im Gegensatz zu den Achsenmächten sind die USA heute beim besten Willen keine „Nichts-Habende-Nation“. Sprich, bei einer faschistischen Revolution gäbe es für viele Amerikaner sehr viel zu verlieren und nur wenig zu gewinnen. In Deutschland etwa sah dies zu Beginn der Dreißigerjahre und im Kontext der Weltwirtschaftskrise für viele scheinbar doch ganz anders aus.
Zudem verfügen die USA über eine lange demokratische Tradition mit entsprechenden Institutionen. Weiterer Radikalisierung und Faschisierung dürften dort daher Grenzen gesetzt sein. Dagegen sprechen natürlich die ersten einhundert Tage von Trumps zweiter Präsidentschaft. Doch haben wir ihn in den letzten Tagen auch immer wieder zögern sehen. Faschismus jedoch ist eine Ideologie der Tat und es wird sich erst noch zeigen müssen, was da im Inneren durchsetzbar ist. Höchst besorgniserregend ist, dass Trump einer imperialen Politik Vorschub leistet. Dies dürfte über Jahre hinaus in vielen Weltgegenden eine stark destabilisierende Wirkung haben.
Faschistische Regime sind nicht nur darauf aus, die eigene Gesellschaft und Kultur aggressiv umzugestalten, sondern setzen auch auf Expansion nach außen. Im Herbst erscheint Ihr neues Buch „München 1938“, das sich mit der Appeasement-Politik in den Dreißigerjahren befasst. Auch heute gibt es viele Menschen, die für einen „realistischen“ Umgang und ein pazifistisches Arrangement mit expansiven Regimen plädieren. Wie sehen Sie das mit einem historischen Blick?
Chamberlains großer Fehler, den ihm die Geschichte nie wirklich verziehen hat, war ja genau, dass er glaubte, Hitler agiere „realistisch“ und habe begrenzte Ziele. Die Münchner Konferenz war das Resultat davon. Und die Folgen waren monströs. Denn über Nacht löste sich eine Grenze, die seit Hunderten von Jahren existierte, in Luft auf. Und nachdem die Grenzen erstmals in Bewegung geraten waren, war an Frieden im Osten Europas nicht mehr zu denken. Ein paar Monate später ließ Hitler dann die sogenannte „Rest-Tschechei“ besetzen. Dies markierte den Übergang von einer völkischen zu einer imperialen Politik. Und ab dann wurde es wirklich blutig. Vor 1938 zählte man die Opfer der Nationalsozialisten in Tausenden, danach in Millionen.
Ein Problem liegt nun darin, dass nicht jeder Möchtegern-Diktator auch gleich der nächste Hitler ist. Nach 1945 sind die „Lehren aus München“ für alle möglichen US-amerikanischen Interventionen bemüht worden. Doch natürlich hatte nicht jeder Diktator vergleichbar weitreichende Pläne. Besänftigung und Koexistenz ist dann durchaus eine Option. Wie der jüngste Friedensvorschlag zeigt, setzt Trump nun offenbar darauf, dass sich Putin durch die Abgabe von ukrainischen Gebieten befrieden lässt. Das ist an sich schon eine sehr riskante Wette.
Aber es geht noch um weit mehr: Die Anerkennung der Annexion der Krim wäre völkerrechtlich ein epochaler Schnitt. Angesichts der Besetzung der Mandschurei 1931 hatten die USA die sogenannte Stimson-Doktrin entwickelt, die besagt, dass die gewaltsame Aneignung von Gebieten nicht anerkannt wird. Dieser Grundsatz fand Eingang in die UN-Charta und ins Völkerrecht und ist vereinfacht gesagt eine der Säulen, auf der die Nachkriegsordnung ruhte. Wenn die USA sich nun davon verabschieden, stellt sich zwangsläufig die Frage für Europa, wie weit man bereit ist, diesen Grundsatz zu verteidigen. Wie unser Buch zeigt, entspricht das in etwa dem Dilemma, dem sich die Vertreter der westlichen Demokratien im Kontext des Appeasements gegenübersahen. So gesehen befinden wir uns wieder im Jahr 1938. Dass wir uns nun aber erneut solchen Fragen akut konfrontiert sehen, zeigt eben auch, wie weit die Abkehr von der bestehenden Weltordnung bereits gediehen ist.
Terminhinweis:
Daniel Hedinger hält am Mittwoch, 7. Mai 2025 um 17:30 Uhr im Rahmen der Jahrestagung des Leipzig Research Centre Global Dynamics eine Keynote zum Thema „Trump and the Global Rise of Fascism“. Im Oktober erscheint sein neues Buch „München 38: Die Welt am Scheideweg“ (C.H. Beck Verlag), das er gemeinsam mit Christian Groeschel verfasst hat. Das Buch beleuchtet die fatalen Folgen der Appeasement-Politik im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs und zieht Parallelen zur heutigen geopolitischen Lage.
Über Daniel Hedinger:
PD Dr. Daniel Hedinger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Research Centre Global Dynamics (ReCentGlobe) und lehrt am Institut für Ostasienwissenschaften. Nach Stationen in Paris, Zürich, Berlin, München, Rom und Kyoto kam er 2024 nach Leipzig. Er ist spezialisiert auf moderne ostasiatische und europäische Geschichte. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen „globalen Faschismus“, die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und kolonialer Gewalt im 20. Jahrhundert aus transimperialer Perspektive. Zusammen mit Nadin Heé leitet er das „Zentrum für transimperiale Geschichte“.
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Dr. Daniel Hedinger
Leipzig Research Centre Global Dynamics (ReCentGlobe)
Telefon: +49 341 97-37807
E-Mail. daniel.hedinger@uni-leipzig.de
Weitere Informationen:
https://recentglobe.uni-leipzig.de/ac25#collapse917767 Keynote im Rahmen der Jahrestagung des Leipzig Research Centre Global Dynamics
Bilder
Merkmale dieser Pressemitteilung:
Journalisten, Wissenschaftler
Geschichte / Archäologie, Politik
überregional
Forschungsergebnisse
Deutsch