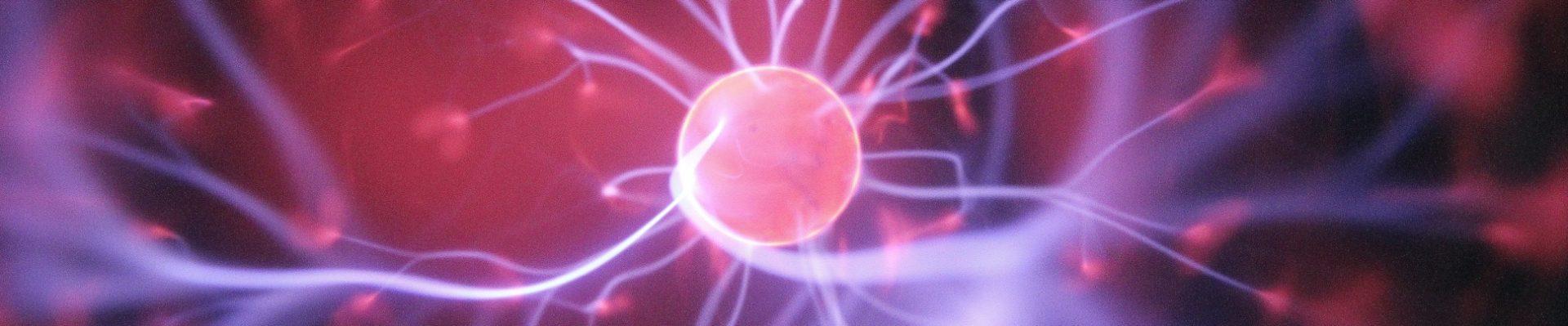Teilen:
16.04.2025 17:17
Meilenstein in der Methanforschung: Wissenschaftler*innen beschreiben Schüsselenzym der biologischen Methanproduktion
Puzzlestück der Klimaforschung – Grundlagenforschung unter dem Kryo-Elektronenmikroskop
Einem Forschungsteam der Philipps-Universität Marburg ist ein Durchbruch in der Methanforschung gelungen. Im Forschungsmagazin „Nature“ veröffentlichen sie neue Erkenntnisse zum Verständnis der Aktivierung der Methyl Coenzym M Reduktase (MCR), eines der häufigsten Enzyme auf der Erde, das für nahezu die gesamte biologische Methanproduktion verantwortlich ist. Methan (CH4) hat ein erheblich höheres Treibhauspotenzial als CO2 und trägt wesentlich zum globalen Klimawandel bei. Die Forschenden um Fidel Ramírez-Amador, Sophia Paul und Dr. Anuj Kumar aus der Arbeitsgruppe von Dr. Jan Schuller haben erstmals den MCR-Aktivierungskomplex aus einem methanogenen Modellorganismus isoliert und charakterisiert. „Wir fanden heraus, dass ein kleines Protein namens McrC in Kombination mit methanogenen Markerproteinen (MMPs), sowie einer ATPase in einem ATP-abhängigen Prozess zusammenwirkt, um MCR zu aktivieren“, erklärt Ramírez-Amador, einer der leitenden Autoren der Studie. „Unsere Ergebnisse verdeutlichen, wie ATP die notwendige Energie liefert, um diesen anspruchsvollen Aktivierungsprozess voranzutreiben und MCR zur Methanproduktion zu befähigen.“
Obwohl MCR seit Jahren untersucht wird, war der genaue Mechanismus seiner Aktivierung in methanogenen Organismen bisher unverstanden. Dies ist unter anderem auf das zentrale Nickelatom des einzigartigen Cofaktors F430 im Zentrum des Enzyms zurückzuführen. Die Aktivierung des Nickels erfordert die Überwindung einer beträchtlichen Energiebarriere, was sie zu einer der herausforderndsten Redoxreaktionen in der Natur macht. Wie frühe Lebensformen diese Aktivierung erreicht haben, ist bis heute eine offene Frage. „Wir glauben, dass die Bindung und Hydrolyse von ATP die katalytische Aktivierung des Coenzyms F430 in MCR auslöst“, berichtet Sophia Paul, ebenfalls Erstautorin der Studie.
Darüber hinaus konnten die Forschenden drei einzigartig koordinierte und hoch spezialisierte Metallverbindungen, sogenannte L-Cluster mithilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie identifizieren, von denen man bisher annahm, sie kämen nur in Nitrogenasen vor, dem einzigen Enzym, das atmosphärischen Stickstoff in bioverfügbare Formen umwandeln kann. „Mit unseren hochauflösenden Kryo-EM-Strukturen können wir nicht nur die Details des L-Clusters auf atomarer Ebene aufdecken, sondern auch verschiedene Funktionszustände des Enzyms erfassen, die den Aktivierungsprozess mit dem komplexen katalytischen Mechanismus von MCR verbinden“, erklärt der Strukturbiologe Dr. Anuj Kumar, Postdoktorand und ebenso Erstautor der Studie. „Diese Ergebnisse stärken nicht nur die Hypothese, dass Methanproduktion und Stickstofffixierung einen gemeinsamen evolutionären Ursprung haben, sondern sie haben auch weitreichende Auswirkungen auf unser Verständnis davon, wie komplexe chemische Reaktionen in energiearmen Umgebungen ablaufen.“
„Unsere Erkenntnisse liefern wertvolle Ansätze für die Klimaforschung, da sie uns langfristig helfen könnten, Methanemissionen gezielt zu regulieren oder gar zu begrenzen. Gleichzeitig erweitern sie unser Verständnis der evolutionären Zusammenhänge zwischen zwei der wichtigsten biogeochemischen Kreisläufe der Erde“, betont Dr. Jan Schuller. „Mit Hilfe modernster Methoden der Kryo-Elektronenmikroskopie konnten wir erstmals ein detailliertes Bild dieses fundamentalen biologischen Prozesses erstellen.“
„Diese Forschungsergebnisse stellen einen Meilenstein im Verständnis grundlegender biochemischer Prozesse dar und unterstreichen einmal mehr die Exzellenz der Universität Marburg im Profilbereich ‚Mikrobiologie, Biodiversität und Klima‘. Ich freue mich sehr für unseren DFG-Emmy-Noether-Gruppenleiter und ERC Starting Grantee, Jan Schuller“, sagt Prof. Dr. Gert Bange, Mentor und Vizepräsident für Forschung der Philipps-Universität Marburg.
Perspektiven der Klimaforschung
Diese neuen Erkenntnisse haben weitreichende Perspektiven. In der Klimaforschung könnte das Verständnis der biologischen Methanproduktion dazu beitragen, die Methanfreisetzung zu regulieren oder sogar zu begrenzen. Gleichzeitig bieten sie Ansatzpunkte, um Methan-abbauende Mikroorganismen, die verwandte Enzyme nutzen, gezielt zu untersuchen und möglicherweise für Klimaschutzmaßnahmen nutzbar zu machen. In der Evolutionsbiologie ist der Nachweis der L-Cluster in der Aktivierungsmaschinerie von MCR ein wichtiger Schritt, um die Verbindungen zwischen Methanbildung und Stickstofffixierung besser zu verstehen. „Dies könnte neue Einblicke in die Entwicklung grundlegender Stoffwechselprozesse liefern und unsere Sicht auf die frühe Evolution des Lebens auf der Erde nachhaltig verändern“, berichtet Erstautorin Sophia Paul.
Bildtext: Die beteiligten Forscher*innen (v.l.n.r.) Dr. Anuj Kumar, Dr. Jan M. Schuller, Fidel Ramírez-Amador, Prof. Dr. Georg Hochberg, Sophia Paul (alle Universität Marburg) and Prof. Dr. Sven Stripp (Universität Potsdam) Foto: Tomas Pascoa
Bild zum Download: https://www.uni-marburg.de/de/aktuelles/news/2025/methan
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Dr. Jan Schuller
Fachbereich Chemie
Zentrum für Synthetische Mikrobiologie
Philipps-Universität Marburg
Tel.: 06421 28-22584
E-Mail: jan.schuller@synmikro.uni-marburg.de
Originalpublikation:
Originalpublikation: Ramírez-Amador, F., Paul, S., Kumar, A. et al. Nature (2025) DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-025-08890-7
Bilder
Merkmale dieser Pressemitteilung:
Journalisten
Biologie, Chemie
überregional
Forschungsergebnisse
Deutsch