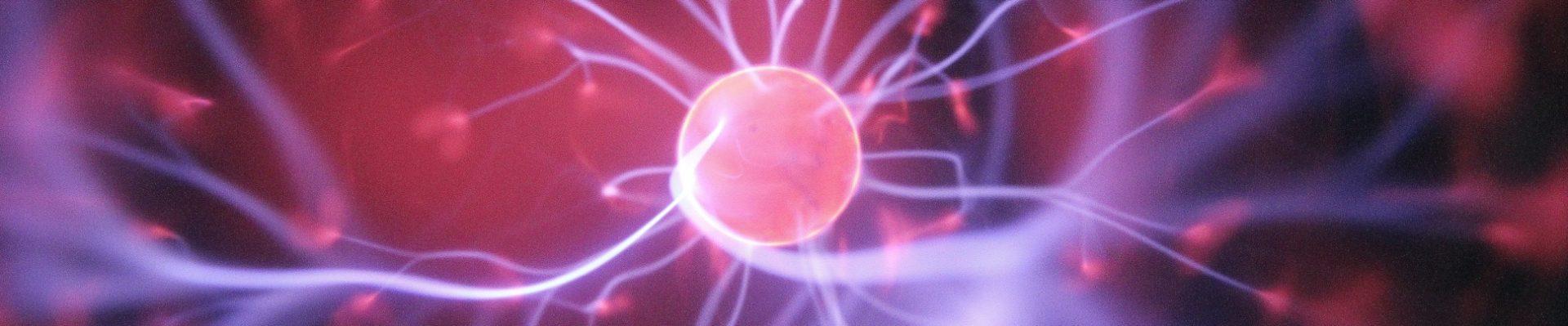01.12.2020 14:23
Sozialer Status beeinflusst gestresste Mäuse je nach Geschlecht
Stress macht Frauen mehr zu schaffen als Männern, wodurch sie einem höheren Risiko für psychische Störungen ausgesetzt sind. Geschlechtsunterschiede und der soziale Kontext tragen zur Entwicklung stressbedingter Störungen bei. Das Zusammenspiel von Geschlecht und sozialen Faktoren ist wichtig für die Reaktion auf chronischen Stress und kann sogar die Physiologie beeinflussen. Die biologischen Mechanismen sind nicht bekannt. Nun konnten Wissenschaftler zeigen, dass soziale Hierarchien und das Geschlecht eine wichtige Rolle bei der Reaktion auf Stress spielen. Männliche und weibliche Mäuse zeigten je nach sozialem Status sogar gegensätzliche Effekte im Umgang mit Stress.
Plötzlich gesund
Fortschreitende Naturerkenntnis, ganz allgemein gesprochen, ‚Wissenschaft‘, ist der stärkste Feind des medizinischen Wunders. Was unseren Vorfahren als Wunder erschien, was einfache Naturvölker heute noch in heftige Erregung versetzt, das berührt den zivilisierten Menschen längst nicht mehr.
Doch es gibt einen Gegensatz, der jedem Denkenden sofort auffällt: der unerhörte, durchaus nicht abgeschlossene Aufstieg der wissenschaftlichen Heilkunde und die ebenso unerhörte Zunahme der Laienbehandlung und der Kurpfuscherei. Man schätzt die Zahl der Menschen, die der Schulmedizin kein Vertrauen schenken, auf immerhin 50 Prozent.
Wie kann es sein, daß Laienbehandler und Kurpfuscher immer wieder spektakuläre Erfolge aufweisen, von denen die Sensationspresse berichtet?
Der Autor geht dieser Frage nach und kommt zu interessanten Erkenntnissen, aus denen er Vorschläge für eine bessere Krankenbehandlung durch seine ärztlichen Standesgenossen ableitet.
Elena Brivio und Stoyo Karamihalev vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München stellten die Hypothese auf, dass die Stellung eines Individuums in der sozialen Hierarchie sein Verhalten bei Stresseinwirkung bestimmt. Außerdem gingen sie davon aus, dass es je nach Geschlecht unterschiedlich ist. Sie installierten ein automatisiertes Beobachtungssystem, das das Verhalten von Mäusen in rein weiblichen oder rein männlichen Gruppen dokumentiert. Gemeinsam mit Kollegen vom Weizmann Institute of Science in Israel ermittelten die Neurowissenschaftler, welche soziale Stellung jedes Tier innerhalb seiner Gruppe innehat. Dann setzten sie einige Gruppen von Mäusen leichtem chronischen Stress aus und verglichen ihr Verhalten mit nicht gestressten Nagetieren.
Geschlecht macht den Unterschied
Das Team konnte bestätigen, dass sowohl das Geschlecht als auch der soziale Status eine Rolle dabei spielen, wie Mäuse mit Stress umgehen. Untergeordnete Männchen zeigten unter Stressbedingungen weniger Angst, während auf der anderen Seite gerade dominante Weibchen mutiger und weniger ängstlich agierten.
„Wir wollten die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Reaktion auf Stress untersuchen“, erklärt eine der Erstautoren Brivio. „Und wir waren sehr überrascht, als wir feststellten, dass der soziale Status bei Männchen und Weibchen entgegengesetzte Auswirkungen hatte“, fügt Co-Erstautor Karamihalev hinzu. Sie erkannten nicht nur, wie der soziale Kontext die Reaktion auf chronischen Stress auf unterschiedliche Weise beeinflusst, sondern dass das Geschlecht zu entgegengesetzten Reaktionen führt.
Diesen gegensätzlichen Reaktionen dürften Unterschiede im Gehirn zugrunde liegen. Um die biologischen Grundlagen dieser sozial- und geschlechtsbedingten Unterschiede in der Stressreaktion zu verstehen, sind weitere Studien erforderlich. Mehr zu erfahren, könnte den Wissenschaftlern helfen zu verstehen, warum manche Menschen anfälliger für Stress sind als andere. Das wiederum könnte zur Entwicklung personalisierter Präventions- oder Behandlungsstrategien für Angst und Depression führen.
Originalpublikation:
elifesciences | http://dx.doi.org/10.7554/eLife.58723
Merkmale dieser Pressemitteilung:
Journalisten
Biologie, Medizin, Psychologie
überregional
Forschungsergebnisse
Deutsch