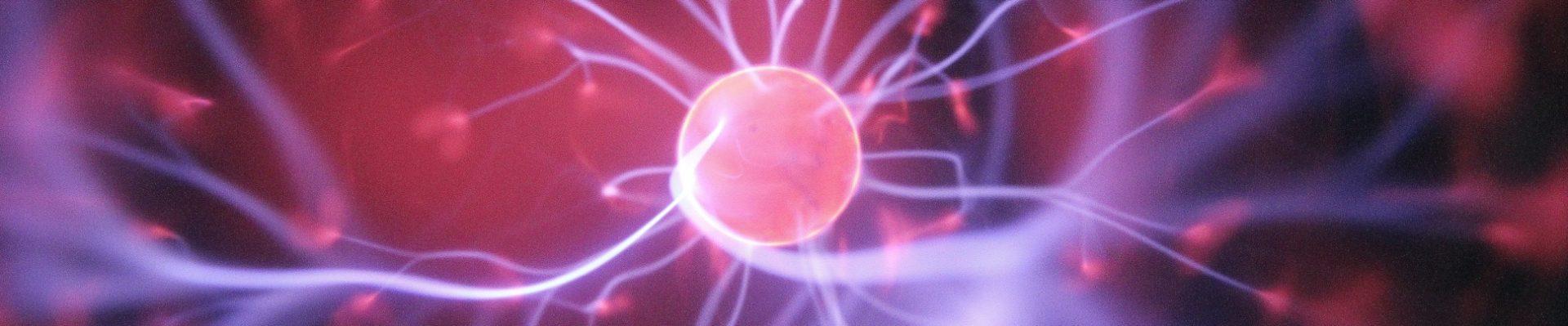Teilen:
21.07.2025 11:05
Plötzlich gesund
Fortschreitende Naturerkenntnis, ganz allgemein gesprochen, ‚Wissenschaft‘, ist der stärkste Feind des medizinischen Wunders. Was unseren Vorfahren als Wunder erschien, was einfache Naturvölker heute noch in heftige Erregung versetzt, das berührt den zivilisierten Menschen längst nicht mehr.
Doch es gibt einen Gegensatz, der jedem Denkenden sofort auffällt: der unerhörte, durchaus nicht abgeschlossene Aufstieg der wissenschaftlichen Heilkunde und die ebenso unerhörte Zunahme der Laienbehandlung und der Kurpfuscherei. Man schätzt die Zahl der Menschen, die der Schulmedizin kein Vertrauen schenken, auf immerhin 50 Prozent.
Wie kann es sein, daß Laienbehandler und Kurpfuscher immer wieder spektakuläre Erfolge aufweisen, von denen die Sensationspresse berichtet?
Der Autor geht dieser Frage nach und kommt zu interessanten Erkenntnissen, aus denen er Vorschläge für eine bessere Krankenbehandlung durch seine ärztlichen Standesgenossen ableitet.
UKE-Forschende entwickeln neue Methode zur Protein-Analyse
Ein internationales Team unter Leitung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) hat eine neue Methode zur hochauflösenden Analyse von Gewebeproben entwickelt. Mit dem Verfahren „Pathologie-orientiertes MultiPlexing (PathoPlex)“ können mehr als 100 verschiedene Proteine gleichzeitig in einer einzigen Gewebeprobe untersuchen werden. Das Verfahren ist universell einsetzbar, ohne dass teure Spezialgeräte benötigt werden.
Mit dem neuen Verfahren, so die Hoffnung der Wissenschaftler:innen, könnten krankheitsauslösende Veränderungen etwa in den Nieren identifiziert und personalisierte Therapien ermöglicht werden. Ihre Studie haben die Forschenden um Prof. Dr. Victor Puelles aus der III. Medizinischen Klinik und Poliklinik des UKE mit Beteiligung des Instituts für Medizinische Systembiologie im Fachmagazin Nature veröffentlicht.
Technologischer Durchbruch mit außergewöhnlicher Auflösung
PathoPlex arbeitet in sich schrittweise wiederholenden Zyklen: Zunächst werden verschiedene Proteine mit Antikörpern markiert, dann werden Bilder aufgenommen, anschließend werden die Antikörper entfernt und der nächste Zyklus gestartet, um weitere Proteine anzufärben. In der Studie führten die Forschenden insgesamt 95 solche Bildgebungszyklen durch. Mithilfe konfokaler Mikroskopie konnten dabei insgesamt 600 Milliarden Bildpunkte mit einer Pixelauflösung von 80 nm – etwa 1000 Mal kleiner als ein menschliches Haar – erfasst werden.
„Ein entscheidender Vorteil von PathoPlex ist die Kompatibilität mit beinahe jedem Fluoreszenzmikroskop – von einfachen Weitfeldmikroskopen bis hin zu hochauflösenden konfokalen Systemen“, sagt Studienleiter und Letztautor Prof. Puelles. Die Methode nutzt dabei handelsübliche Antikörper und kann bis zu 40 Archivproben parallel verarbeiten. Zur Bewältigung der großen Datenmengen entwickelten die Forschenden die Software „spatiomic“, die automatisch Protein-Koexpressionsmuster identifiziert, räumliche Analysen ermöglicht und frei verfügbar ist.
Neue Erkenntnisse bei Nierenerkrankungen
Bei der Untersuchung diabetischer Nierenerkrankungen mit PathoPlex identifizierten die Wissenschaftler:innen Stresssignale in den Nierentubuli als neue, möglicherweise krankheitsauslösende Auswirkungen. Auch bei Typ-2-Diabetes-Patient:innen ohne Funktionsverlust der Niere konnten Veränderungen nachgewiesen werden – ein wichtiger Schritt in Richtung einer verbesserten Früherkennung und Behandlung von Diabetes-Komplikationen. Zudem erwies sich die Methode als geeignet, um die Wirkung von Antidiabetika wie SGLT2-Hemmern in dieser Patient:innen-Gruppe zu bewerten.
Internationale Zusammenarbeit
Die multidisziplinäre Studie entstand in Kooperation zwischen dem UKE und der Universität Aarhus (Dänemark) sowie zahlreichen internationalen Forschenden in Japan, Deutschland, Australien, Frankreich, der Schweiz und den USA. Das Projekt wurde unter anderem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert.
Publikation: Kuehl, Puelles et al. Pathology-oriented multiplexing enables integrative disease mapping. Nature. 2025.
DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-025-09225-2
Originalpublikation:
https://doi.org/10.1038/s41586-025-09225-2
Bilder
Merkmale dieser Pressemitteilung:
Journalisten, Wissenschaftler
Medizin
überregional
Forschungsergebnisse, Wissenschaftliche Publikationen
Deutsch