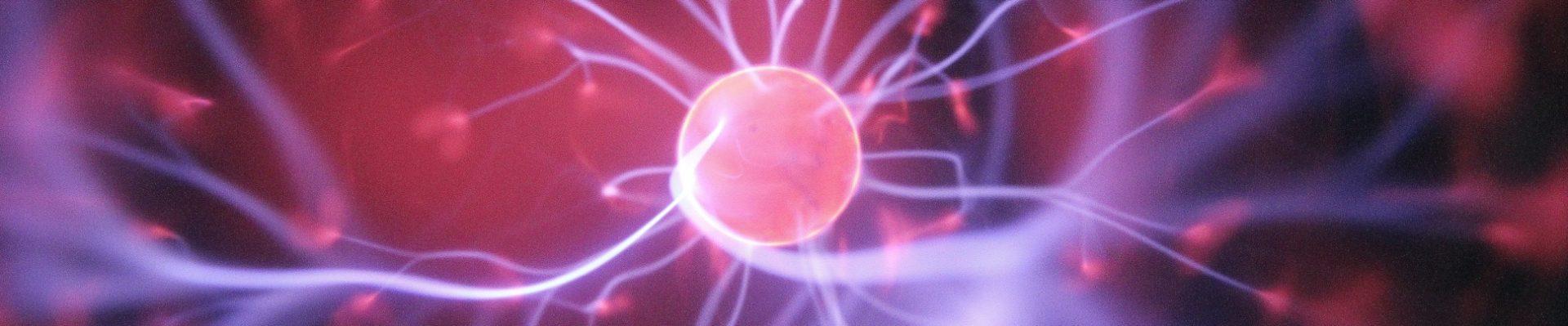Teilen:
25.07.2025 11:35
Plötzlich gesund
Fortschreitende Naturerkenntnis, ganz allgemein gesprochen, ‚Wissenschaft‘, ist der stärkste Feind des medizinischen Wunders. Was unseren Vorfahren als Wunder erschien, was einfache Naturvölker heute noch in heftige Erregung versetzt, das berührt den zivilisierten Menschen längst nicht mehr.
Doch es gibt einen Gegensatz, der jedem Denkenden sofort auffällt: der unerhörte, durchaus nicht abgeschlossene Aufstieg der wissenschaftlichen Heilkunde und die ebenso unerhörte Zunahme der Laienbehandlung und der Kurpfuscherei. Man schätzt die Zahl der Menschen, die der Schulmedizin kein Vertrauen schenken, auf immerhin 50 Prozent.
Wie kann es sein, daß Laienbehandler und Kurpfuscher immer wieder spektakuläre Erfolge aufweisen, von denen die Sensationspresse berichtet?
Der Autor geht dieser Frage nach und kommt zu interessanten Erkenntnissen, aus denen er Vorschläge für eine bessere Krankenbehandlung durch seine ärztlichen Standesgenossen ableitet.
Welche Signalwege in der Zelle zu möglichen Therapien gegen Parkinson führen
Neue Auslöser für Mitophagie – einem Selbstreinigungsprozess der Zelle – gefunden
Die Autophagie ist quasi die „Müllabfuhr“ unserer Zellen. Gibt es Probleme in diesem für die Gesundheit so wichtigen Prozess, können Krankheiten wie Parkinson die Folge sein. Führende Zellbiolog*innen an den Max Perutz Labs der Universität Wien haben in ihrer aktuellen Studie die Mitophagie – eine Form der Autophagie – untersucht und kamen zu einer bemerkenswerten Erkenntnis: Die Forscher*innen haben einen neuen Auslöser der Mitophagie beschrieben. Diese Erkenntnis hat eine Neubewertung der Hierarchie der auslösenden Faktoren bei der Autophagie zur Folge. Die neu entdeckten Signalwege könnten auch neuartige Therapiemöglichkeiten eröffnen. Die Studie wurde aktuell im renommierten Fachmagazin Nature Cell Biology publiziert.
Die Autophagie ist ein Selbstreinigungsprozess der Zelle und entscheidend für die Zellgesundheit im menschlichen Körper. Dabei identifiziert ein ausgeklügeltes molekulares Überwachungskommando verdächtige Substanzen – kaputte Zellbestandteile, verklumpte Proteine oder auch Krankheitserreger – und veranlasst ihren Abtransport. Schließlich werden defekte Zellbestandteile zerlegt und wiederverwertet. Die Mitophagie bezeichnet eine Form der Autophagie, bei der gezielt Mitochondrien innerhalb einer Zelle abgebaut werden. Insbesondere eine Fehlregulation der Mitophagie steht im Zusammenhang mit der Parkinson-Krankheit. Diesen Prozess besser zu verstehen, ist also bedeutsam für die Bekämpfung von Parkinson.
In einer neuen Studie unter der Leitung von Postdoktorand Elias Adriaenssens aus der Gruppe um Sascha Martens von den Max Perutz Labs der Universität Wien enthüllen die Wissenschafter*innen einen neuen Mechanismus für die Auslösung der Mitophagie. Bisher hat sich die Forschung stark auf den „PINK1/Parkin-Signalweg“ konzentriert. Über Signalwege werden Informationen in der Zelle weitergeleitet. Diese komplexen Netzwerke aus Molekülen steuern kritische zelluläre Funktionen wie Wachstum, Teilung, Zelltod und eben auch die Mitophagie.
„Als wir das Gesamtbild betrachteten wurde klar, dass es abseits vom viel untersuchten ‚PINK1/Parkin-Signalweg‘ enorme Wissenslücken in Bezug auf andere Mitophagie-Signalwege gab“, erklärt Studienleiter Elias Adriaenssens. „Unser Labor hat diese vernachlässigten Bereiche erforscht, indem wir biochemische Rekonstitutionen nutzten, um grundlegende mechanistische Erkenntnisse zu gewinnen.“
Neu entdeckte Signalwege sind keine Ausnahme
„Wir haben festgestellt, dass NIX und BNIP3 – zwei bekannte Mitophagie-Rezeptoren – die Autophagie auslösen können, ohne an FIP200 (ein Protein) zu binden, was ziemlich unerwartet war“, erklärt Adriaenssens. FIP200 gilt als essenziell für das Auslösen der Autophagie. „Das hat uns vor ein Rätsel gestellt. Trotz umfangreicher Tests konnten wir keine Wechselwirkung von FIP200 mit einem der beiden Rezeptoren nachweisen – was die entscheidende Frage aufwirft, wie sie ohne diese vermeintlich entscheidende Komponente funktionieren“, fügt er hinzu. Die Massenspektrometrie ergab jedoch, dass sich andere Autophagie-Komponenten, sogenannte WIPI-Proteine, an diese mitochondrialen Rezeptoren binden. Da man bisher davon ausging, dass WIPI-Proteine erst später im Signalweg wirken, war ihre Beteiligung an der Auslösung der Autophagie überraschend. Folgeexperimente bestätigten diese Wechselwirkungen und deuteten darauf hin, dass die WIPI-vermittelte Rekrutierung keine Ausnahme darstellt, sondern möglicherweise bisher unbekannte Wege in der selektiven Autophagie vermittelt.
„Das ist eine spannende Entdeckung – sie offenbart einen parallelen Auslöser für selektive Autophagie. Anstelle eines einzigen, universellen Mechanismus scheinen Zellen je nach Rezeptor und Kontext unterschiedliche molekulare Strategien zu verwenden. Bislang hat niemand WIPI-Proteine als zentrale Akteure bei der Auslösung der Autophagosomenbildung betrachtet, aber unsere Entdeckung könnte diese Sichtweise ändern“, erklärt Adriaenssens.
Potenzial für neue Therapien der Parkinson-Krankheit
Mit Blick auf die Zukunft wirft die Studie eine wichtige Frage auf: Wie entscheiden Zellen zwischen alternativen Mitophagie-Signalwegen – warum nutzen manche Rezeptoren den einen und andere den anderen, und welche Faktoren bestimmen, welcher Signalweg genutzt wird? Die Unterscheidung zwischen selektiven Mitophagie-Signalwegen könnte den Weg für Therapien ebnen, die gezielt einen Signalweg aktivieren, um Defekte im anderen auszugleichen, was langfristig Potenzial für die Behandlung der Parkinson-Krankheit hat.
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Univ.-Prof. Dipl.-Biol. Dr. Sascha Martens, Privatdoz.
Department für Biochemie und Zellbiologie,
Universität Wien
1030 Wien, Dr.-Bohr-Gasse 9
T +43-1-4277-52876
sascha.martens@univie.ac.at
www.univie.ac.at
Originalpublikation:
Originalpublikation in Nature Cell Biology: https://www.nature.com/articles/s41556-025-01712-y
Bilder
Sascha Martens (links) and Elias Adriaenssens (rechts).
Copyright: Max Perutz Labs
Merkmale dieser Pressemitteilung:
Journalisten, Wissenschaftler
Biologie, Medizin
überregional
Forschungs- / Wissenstransfer, Forschungsergebnisse
Deutsch