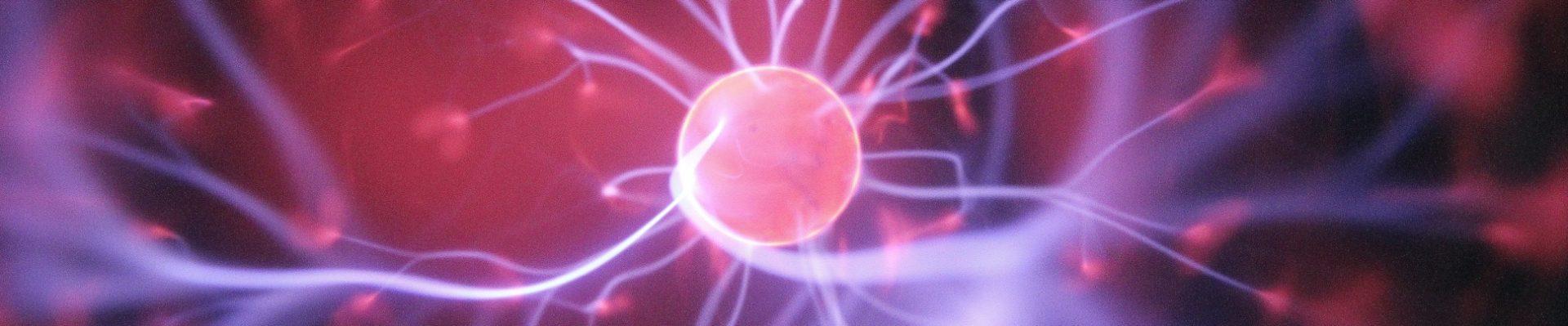Teilen:
11.09.2025 21:00
Plötzlich gesund
Fortschreitende Naturerkenntnis, ganz allgemein gesprochen, ‚Wissenschaft‘, ist der stärkste Feind des medizinischen Wunders. Was unseren Vorfahren als Wunder erschien, was einfache Naturvölker heute noch in heftige Erregung versetzt, das berührt den zivilisierten Menschen längst nicht mehr.
Doch es gibt einen Gegensatz, der jedem Denkenden sofort auffällt: der unerhörte, durchaus nicht abgeschlossene Aufstieg der wissenschaftlichen Heilkunde und die ebenso unerhörte Zunahme der Laienbehandlung und der Kurpfuscherei. Man schätzt die Zahl der Menschen, die der Schulmedizin kein Vertrauen schenken, auf immerhin 50 Prozent.
Wie kann es sein, daß Laienbehandler und Kurpfuscher immer wieder spektakuläre Erfolge aufweisen, von denen die Sensationspresse berichtet?
Der Autor geht dieser Frage nach und kommt zu interessanten Erkenntnissen, aus denen er Vorschläge für eine bessere Krankenbehandlung durch seine ärztlichen Standesgenossen ableitet.
Objekte stärken unseren inneren Kompass
Deutsch-kanadische Studie unter Federführung der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) zeigt, dass das Betrachten von Objekten dazu beiträgt, das Navigationssystem des Gehirns zu verbessern. Die Ergebnisse der Studie sind in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht.
In unserem Alltag nutzen wir Objekte als räumliche Orientierungspunkte – wie beispielsweise einen bestimmten Uhrenturm beim Spaziergang durch die Stadt – um die richtige Richtung zu finden. Dies funktioniert, weil unser Gehirn einen Großteil seiner Rechenleistung darauf verwendet, die Welt in Objekte zu zerlegen. Zudem wird unsere aktuelle Position in der Welt ständig von spezialisierten Nervenzellen im räumlichen Navigationssystem des Gehirns verarbeitet, den sogenannten Orts-, Gitter- und Kopfausrichtungszellen. Die Aktivität der Kopfausrichtungszellen ist dabei auf einen engen Bereich von Kopfausrichtungen abgestimmt. Das bedeutet, beim Drehen des Kopfes in eine bestimmte Richtung sind nur die für diese Kopfausrichtung zuständigen Zellen aktiv, während die anderen gehemmt werden. Es ist jedoch noch nicht ausreichend geklärt, wie die Objekte das Zusammenspiel dieser Nervenzellen und damit den Orientierungssinn beeinflussen.
Forschende unter der Leitung von Prof. Dr. Emilie Macé, Leiterin der Arbeitsgruppe „Brain-wide networks“ in der Klinik für Augenheilkunde der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Co-Sprecherin des Else Kröner Fresenius Zentrums für Optogenetische Therapien der UMG sowie Mitglied im Exzellenzcluster „Multiscale Bioimaging: Von molekularen Maschinen zu Netzwerken erregbarer Zellen“ (MBExC), haben zusammen mit kanadischen Kooperationspartner*innen gezeigt, dass eine für den inneren Kompass wichtige Hirnregion, das Postsubiculum, aktiviert wird, wenn Mäuse Objekte betrachten. Zudem wurde beobachtet, dass beim Betrachten eines Objekts die auf diese Richtung abgestimmten Kopfrichtungszellen aktiver waren als ohne das Objekt. Andererseits wurden die auf andere Richtungen abgestimmten Kopfrichtungszellen stärker gehemmt. Infolgedessen wird die Richtung des Objekts durch die Kopfausrichtungszellen genauer dargestellt.
„Wir haben alle schon erlebt, wie uns Orientierungspunkte wie Gebäude ein sicheres Gefühl dafür vermitteln, wo wir uns gerade befinden. Aber wie das Gehirn solche visuellen Hinweise nutzt, um unseren Orientierungssinn zu verbessern, ist jedoch noch unklar. In unserer Studie haben wir ein Teil dieses Puzzles gefunden, wir haben eine Gehirnregion identifiziert, in der Nervenzellen sowohl auf die Richtung des Kopfes als auch auf die Anwesenheit von Objekten reagieren. Wenn ein Objekt gesehen wird, werden die Nervenzellen, die die Kopfausrichtung kodieren, präziser – sie schärfen sozusagen unseren inneren Kompass. Das zeigt, dass Objekte uns helfen, uns besser zu orientieren, indem sie die Richtungssignale des Gehirns verbessern“, sagt Prof. Macé, Letztautorin der Studie.
Die Ergebnisse der Studie sind in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht.
Originalpublikation:
Dominique Siegenthaler, Henry Denny, Sofía Skromne Carrasco, Johanna Luise Mayer, Daniel Levenstein, Adrien Peyrache, Stuart Trenholm und Emilie Macé. Visual objects refine head direction coding. Science (2025). DOI: 10.1126/science.adu9828
Die Studie im Detail
Um herauszufinden, welche Teile des Gehirns auf Objekte wie beispielsweise Gegenstände oder Gebäude reagieren, haben die Forschenden die Gehirnaktivität im Mausmodell analysiert. Während den Tieren 48 Bilder mit Objekten und 48 Bilder ohne Objekte gezeigt wurden, wurden sie mittels funktioneller Ultraschall-Bildgebung untersucht. Diese Methode misst die Zunahme des Blutvolumens, wenn ein Teil des Gehirns aktiver wird. Auf diese Weise konnten die Forschenden Gehirnregionen identifizieren, die bevorzugt auf Objekte reagierten.
„Überraschenderweise zeigte die Methode, dass das Postsubiculum, eine Hirnregion, die viele Kopfausrichtungszellen enthält, die stärkste Präferenz für Objekte aufwies, und wir fragten uns, wie visuelle Signale die Aktivität dieser Kopfausrichtungszellen beeinflussen“, sagt Dr. Dominique Siegenthaler, Postdoktorand in der Arbeitsgruppe „Brain-wide networks“ von Prof. Macé und Erstautor der Studie.
Dazu untersuchte die Gruppe detailliert, wie Nervenzellen in dieser Hirnregion aktiviert werden, wenn sich die Mäuse frei in einer weißen Box bewegen durften, an deren Wand nur ein einziges Objektbild angebracht war. Die elektrischen Signale wurden zusammen mit der Position und dem Blick der Maus in der Box aufgezeichnet. Dabei zeigte sich, dass Nervenzellen, die auf eine bestimmte Richtung abgestimmt waren, verstärkt wurden, wenn die Maus das Objekt in dieser Richtung ansah. Ein Computermodell konnte die experimentellen Beobachtungen reproduzieren.
Um die Aktivierung der Kopfausrichtungszellen weiter zu untersuchen, wurde ein weiteres Experiment durchgeführt. Mäuse konnten sich frei in einer weißen Box bewegen, an deren Wand ein einzelnes Objektbild angebracht war. Die elektrischen Signale der Nervenzellen im Postsubiculum wurden zusammen mit der Position und der Kopfausrichtung der Maus in der Box aufgezeichnet. Dabei zeigte sich, dass die Nervenzellen, die auf eine bestimmte Richtung abgestimmt waren, stärker reagierten, wenn die Maus das Objekt sehen konnte beziehungsweise sie in diese Richtung blickte. Ein Computermodell bestätigte die experimentellen Beobachtungen.
An der Studie beteiligte Partnerinstitutionen
Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz in Planegg sowie das Montreal Neurological Institute der McGill University und das Mila – Quebec AI Institute, beide in Montreal, Kanada.
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Prof. Dr. Emilie Macé, Klinik für Augenheilkunde, Telefon 0551 / 39-61117, emilie.mace@med.uni-goettingen.de
Originalpublikation:
Dominique Siegenthaler, Henry Denny, Sofía Skromne Carrasco, Johanna Luise Mayer, Daniel Levenstein, Adrien Peyrache, Stuart Trenholm und Emilie Macé. Visual objects refine head direction coding. Science (2025). DOI: 10.1126/science.adu9828
Bilder
Prof. Dr. Emilie Macé, Leiterin der Arbeitsgruppe „brain-wide networks“ in der Klinik für Augenheilk …
Copyright: privat
Prof. Dr. Emilie Macé, Leiterin der Arbeitsgruppe „brain-wide networks“ in der Klinik für Augenheilk …
Copyright: dorothea laurence
Merkmale dieser Pressemitteilung:
Journalisten
Biologie, Medizin
überregional
Forschungsergebnisse, Kooperationen
Deutsch