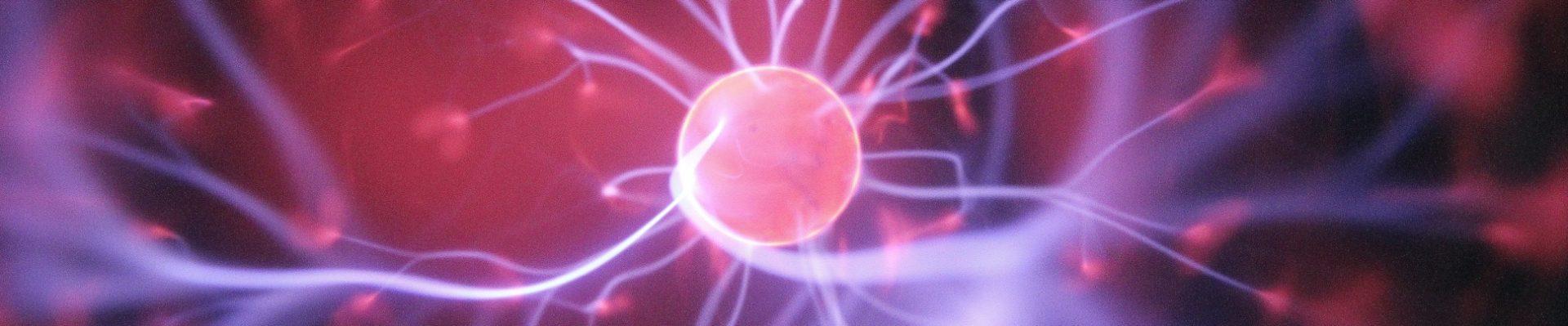Teilen:
07.02.2025 12:02
Plötzlich gesund
Fortschreitende Naturerkenntnis, ganz allgemein gesprochen, ‚Wissenschaft‘, ist der stärkste Feind des medizinischen Wunders. Was unseren Vorfahren als Wunder erschien, was einfache Naturvölker heute noch in heftige Erregung versetzt, das berührt den zivilisierten Menschen längst nicht mehr.
Doch es gibt einen Gegensatz, der jedem Denkenden sofort auffällt: der unerhörte, durchaus nicht abgeschlossene Aufstieg der wissenschaftlichen Heilkunde und die ebenso unerhörte Zunahme der Laienbehandlung und der Kurpfuscherei. Man schätzt die Zahl der Menschen, die der Schulmedizin kein Vertrauen schenken, auf immerhin 50 Prozent.
Wie kann es sein, daß Laienbehandler und Kurpfuscher immer wieder spektakuläre Erfolge aufweisen, von denen die Sensationspresse berichtet?
Der Autor geht dieser Frage nach und kommt zu interessanten Erkenntnissen, aus denen er Vorschläge für eine bessere Krankenbehandlung durch seine ärztlichen Standesgenossen ableitet.
Energie sparen ist „in“, selbst Neurone machen mit
Nervenzellen haben erstaunliche Strategien, wie sie Energie sparen können und trotzdem die wichtigsten ihrer Aufgaben erfüllen können. Forschende des Universitätsklinikums Bonn (UKB) und der Universität Bonn sowie der Universitätsmedizin Göttingen fanden heraus, dass das neuronale Energieeinsparprogramm den Ort und die Anzahl der Boten-RNA (mRNA) und Proteine bestimmt, und je nach Länge, Langlebigkeit und anderen Eigenschaften des jeweiligen Moleküls unterscheidet. Die Arbeit ist jetzt in dem Fachjournal „Nature Communications“ veröffentlicht.
Die Notwendigkeit zum Energiesparen haben wir alle in den letzten Jahren erlebt. Dazu mussten wir uns alle Strategien überlegen, wie wir Energie sparen können und trotzdem unsere wichtigsten Bedürfnisse erfüllen. „In einem ähnlichen Dilemma befinden sich auch unsere Nervenzellen: Sie müssen ihre Synapsen, also ihre Kontaktstellen zu anderen Neuronen, versorgen, aber auch ihre Protein-Synthese so organisieren, dass sie nicht zu viel und nicht zu wenig von diesen produzieren. Gleichzeitig müssen sie die Proteine über lange Distanzen zu den Synapsen transportieren und auch auf ihr Energiebudget achten. Doch wie schaffen sie das?“, fragte sich das Forschungsteam um Korrespondenzautorin Prof. Prof. Tatjana Tchumatchenko, Forschungsgruppenleiterin am Institut für Experimentelle Epileptologie und Kognitionsforschung des UKB sowie Mitglied im Transdisziplinären Forschungsbereichen (TRA) „Life and Health“ und „Modelling“ der Universität Bonn.
Energiesparmaßnahmen erklären Proteinverteilungen
Trotz seiner relativ geringen Größe verbraucht das Gehirn etwa 20 Prozent der gesamten Energie des Körpers. Wie bei allen Zellen unterliegen auch die neuronalen Funktionen strengen Energiebeschränkungen, die im Gehirn auf Grund seines hohen Energiebedarfs besonders ausgeprägt sind. Das Forschungsteam konnte zeigen, dass die Synthese und der Abbau aller neuronalen Moleküle einen besonders hohen zellulären Energieaufwand darstellt und daher Sparmaßnahmen erfordert. Für ihre Funktionsfähigkeit benötigen alle Zellen Proteine, so auch Neurone. Diese werden durch den Prozess der so genannten Genexpression produziert, bei dem die jeweiligen Informationen von einem Gen in die Boten RNA (mRNA) kopiert werden. Die reife mRNA wird anschließend in das benötigte Protein übersetzt. Dank der Fortschritte in der Biochemie und Mikroskopie ist es heute möglich, den Ort einzelner mRNA-Kopien und der entsprechenden Proteine in Zellen präzise zu kartieren und die Anzahl für Tausende von mRNA- und Proteinarten zu quantifizieren. Das ermöglicht den Forschenden erstmals, komplexe Organisationsprinzipien zu untersuchen, die die räumlichen Genexpressionsmuster steuern und über alle Molekülarten hinweg gelten.
Das Forschungsteam kombinierte experimentelle Daten aus mehr als zehn groß angelegten mRNA- und Proteomics-Screens, die Zehntausende Molekülarten umfassten. „Wir fanden heraus, dass das Bestreben, Energie zu sparen, die mRNA- und Protein-Anzahl sowie deren Ort bestimmt und dabei auf jede Molekülspezies unterschiedlich wirkt – je nach Länge, Lebensdauer und anderen Eigenschaften des jeweiligen Moleküls“, erläutert Erstautor Cornelius Bergmann, Doktorand der Universität Bonn am Institut für Experimentelle Epileptologie und Kognitionsforschung des UKB.
Die Ergebnisse zeigen, dass die energetischen Kosten für Synthese, Transport und Abbau von Molekülen, ihre räumliche Lokalisierung und die Gesamtanzahl auf energieeffiziente Lösungen beschränken. „Würden bestimmte kurzlebige Proteine im Zellkörper synthetisiert, würde ein großer Teil von ihnen aufgrund der langen Reisedauer nicht lebend an den Synapsen ankommen“, ergänzt Prof. Tchumatchenko. „Dies wäre eine Energieverschwendung an Proteine, die ihre Aufgabe nicht erfüllen können.“ Die Modellberechnungen in der vorliegenden Arbeit zeigen, dass Proteine daher vorzugsweise in den verzweigten, sich verjüngenden Fortsätzen einer Nervenzelle, den so genannten Dendriten, synthetisiert werden, wenn der Energieverlust „auf dem Weg“ vom Zellkörper zu den Synapsen größer ist als der Energieaufwand für den Transport der mRNA in die Dendriten.
Neue Sichtweise auf Genexpressionsstudien
Die Erkenntnisse des Forschungsteams gehen jedoch über die Energieeinsparung hinaus. „Unsere Ergebnisse werfen ein Licht auf die Organisationsprinzipien der Genexpression in Zellen, die über verschiedene molekulare Spezies hinweg wirken und über einzelne Regulationsmechanismen hinausgehen“, sagt Co-Autor Prof. Silvio Rizzoli, Direktor des Instituts für Neuro- und Sinnesphysiologie der Universitätsmedizin Göttingen, Sprecher des Center for Biostructural Imaging of Neurodegeneration (BIN) sowie Mitglied des Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging: von molekularen Maschinen zu Netzwerken erregbarer Zellen“ (MBExC).
Das überraschendste Ergebnis für das Forschungsteam war, dass die physikalischen Eigenschaften von Proteinen, wie Länge oder Lebensdauer, und nicht deren spezifische Funktion, einen so starken Einfluss auf das Energiebudget und damit auf den Ort ihrer Synthese haben. Co-Autor Kanaan Mousaei, Doktorand der Universität Bonn am Institut für Experimentelle Epileptologie und Kognitionsforschung des UKB, betont: „Unser Modell bietet eine neue Perspektive, um Dutzende existierende Datensätze aus verschiedenen Laboren miteinander in Beziehung zu setzen.“
Förderung:
ERC Starting Grant MolDynForSyn verliehen vom Europäischen Forschungsrat.
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Prof. Tatjana Tchumatchenko
Institut für Experimentelle Epileptologie und Kognitionsforschung
Universitätsklinikum Bonn
TRA „Modelling“ & „Life and Health“, Universität Bonn
E-Mail: tatjana.tchumatchenko@uni-bonn.de
Originalpublikation:
Cornelius Bergmann, Kanaan Mousaei, Silvio Rizzoli, Tatjana Tchumatchenko: How energy determines spatial localisation and copy number of molecules in neurons; Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-025-56640-0
https://www.nature.com/articles/s41467-025-56640-0
Bilder
Neuronen können Energie sparen, wenn sie manche Proteine direkt in ihren Dendriten (rechts im Bild) …
Illustration by Julia Kuhl
Merkmale dieser Pressemitteilung:
Journalisten
Medizin
überregional
Forschungsergebnisse, Wissenschaftliche Publikationen
Deutsch