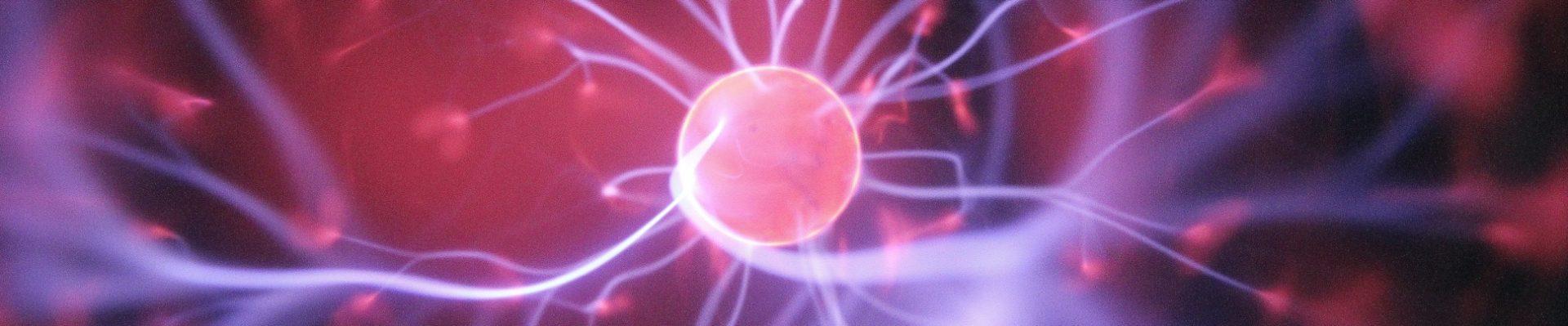Teilen:
12.02.2026 10:23
Plötzlich gesund
Fortschreitende Naturerkenntnis, ganz allgemein gesprochen, ‚Wissenschaft‘, ist der stärkste Feind des medizinischen Wunders. Was unseren Vorfahren als Wunder erschien, was einfache Naturvölker heute noch in heftige Erregung versetzt, das berührt den zivilisierten Menschen längst nicht mehr.
Doch es gibt einen Gegensatz, der jedem Denkenden sofort auffällt: der unerhörte, durchaus nicht abgeschlossene Aufstieg der wissenschaftlichen Heilkunde und die ebenso unerhörte Zunahme der Laienbehandlung und der Kurpfuscherei. Man schätzt die Zahl der Menschen, die der Schulmedizin kein Vertrauen schenken, auf immerhin 50 Prozent.
Wie kann es sein, daß Laienbehandler und Kurpfuscher immer wieder spektakuläre Erfolge aufweisen, von denen die Sensationspresse berichtet?
Der Autor geht dieser Frage nach und kommt zu interessanten Erkenntnissen, aus denen er Vorschläge für eine bessere Krankenbehandlung durch seine ärztlichen Standesgenossen ableitet.
K.O.-Tropfen: Betroffene wünschen sich mehr Aufklärung und Prävention
Neue Erkenntnisse aus der länderübergreifenden K.O.-Tropfen-Studie „Don’t knock me out“: Betroffene wenden sich eher an vertraute Personen als an medizinisches Personal oder die Polizei und wünschen sich facettenreiche Bereitstellung von Informationen zu „Drink Spiking“
Im Januar 2026 gab Jun.-Prof. Dr. Charlotte Förster, Inhaberin der Juniorprofessur Europäisches Management an der Technischen Universität Chemnitz, Einblick in die ersten Ergebnisse der länderübergreifenden K.O.-Tropfen-Studie „Don’t knock me out“. Nun folgen weitere Erkenntnisse aus der noch laufenden anonymen Online-Umfrage zur Bekanntheit, Erfahrung und dem Umgang mit K.O.-Tropfen im deutschsprachigen Raum.
Aus den 1.288 ausgewerteten Datensätzen für Deutschland wissen wir, dass 527 Personen schon mindestens einmal den Verdacht hatten, Opfer von „Drink Spiking“, also der unfreiwilligen Verabreichung von als K.O.-Tropfen missbrauchten Substanzen, geworden zu sein. „Die Ergebnisse weisen allerdings auch auf eine große Lücke zwischen den berichteten Erfahrungen und den institutionell erfassten Fällen hin“, berichtet Förster. Es scheint so, dass sich Personen, die einen solchen Verdacht haben, eher an vertraute Personen wie Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde, Partnerinnen und Partner oder Bekannte wenden, nicht aber an medizinisches Personal oder die Polizei. Dies betraf 95 Prozent der Personen, die einen solchen Verdacht hatten und diesen auch jemand anvertrauten. Nur 70 Personen, also 17 Prozent dieser Gruppe, wandten sich (auch) an eine Ärztin oder einen Arzt, beispielsweise in der Notaufnahme oder in der Hausarztpraxis. Weiterhin meldeten nur 48 Personen, also elf Prozent dieser Gruppe, den Verdacht (auch) bei der Polizei. 20 Prozent der befragten Personen mit einem solchen Verdacht gaben darüber hinaus an, ihren Verdacht nie jemandem anvertraut zu haben.
Diese Erkenntnisse stehen im Einklang mit den Ergebnissen der kürzlich veröffentlichten Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag“ (LeSuBiA) – eine Dunkelfeldbefragung der Bundesregierung zu Gewalt in Deutschland. Auch diese Studie zeigt, dass Gewalterfahrungen nur selten angezeigt werden, wobei Frauen von partnerschaftlicher oder geschlechtsspezifischer Gewalt stärker und häufiger betroffen sind als Männer. „Unsere Studienerkenntnisse sind damit also durchaus anschlussfähig“, resümiert Förster.
Für die Chemnitzer Juniorprofessorin ist es wichtig zu betonen, dass es sich um eine laufende Analyse handelt und dass diese Studie keinen repräsentativen Anspruch erhebt. „Für eine solche Datenerhebung fehlt uns an der Juniorprofessur das entsprechende Budget. Dennoch können wir mittels unserer Studie wichtige Erkenntnisse gewinnen, insbesondere wenn es um die Gründe geht, warum Verdachtsfälle institutionell nicht erfasst werden“, erklärt Förster. „Wir können beispielsweise aus den Ergebnissen ableiten, dass es so scheint, als ob Personen nicht wissen, wie sie sich bei einem solchen Verdacht verhalten sollen, oder dass sie bei den entsprechenden Stellen abgewiesen werden. Auch hierfür liefert unsere Studie Hinweise. Weiterhin spielen Scham und das Thema Victim-blaming – also die Beschuldigung von Opfern – eine wichtige Rolle.“ Das spricht dafür, dass die Verantwortlichkeiten nicht ganz klar zu sein scheinen, die Personen möglicherweise Angst haben ihren Verdacht zu äußern und es auch ein Aufklärungsproblem zu geben scheint. „Es ist deshalb wichtig, dass Personen, die einen solchen Verdacht haben oder in Begleitung einer solchen Person sind, genau wissen, was zu tun ist.“
65 Prozent der Befragten bewerten die betriebene Aufklärung zum Thema K.O.-Tropfen als nicht oder eher nicht ausreichend. 71 Prozent der Befragten gaben darüber hinaus an, nicht oder eher nicht das Gefühl zu haben, dass es ausreichend Präventionsmöglichkeiten zum Thema K.O.-Tropfen bzw. „Drink Spiking“ gibt. In der Verantwortung für eine solche Aufklärung und Bereitstellung von Informationen sahen die Befragten gleichermaßen Bildungseinrichtungen wie Schulen und Hochschulen (76 Prozent) sowie Ausgeh-Locations wie Bars, Clubs und Diskotheken (76 Prozent). Darüber hinaus sahen die Befragten auch öffentliche Institutionen wie Polizei oder öffentliche Gesundheit (74 Prozent) sowie die öffentlichen Medien (72 Prozent) in der Pflicht. Arztpraxen und Apotheken sahen die Befragten hingegen eher weniger in der Verantwortung für die Aufklärung und Bereitstellung von Informationen, sondern vielmehr als Orte, an denen Aufklärung betrieben bzw. Informationen bereitgestellt werden sollten. Darüber hinaus wünschen sich die Befragten insbesondere mehr Aufklärung in Ausgeh-Locations (90 Prozent), Bildungseinrichtungen (86 Prozent), öffentlichen Verkehrsmitteln (67 Prozent) und öffentlichen Institutionen (53 Prozent). Als bevorzugte Wege der Aufklärung wurden insbesondere der Schulunterricht (83 Prozent), Social-Media-Plattformen (78 Prozent), das Internet (72 Prozent) und Streamingdienste (45 Prozent) sowie über Plakate (47 Prozent) und Flyer und Broschüren (40 Prozent) genannt. Hinsichtlich der Themen, über die sich die Befragten mehr Aufklärung wünschten, stachen neben weiteren wichtigen Fragen insbesondere die Themen Nachweisbarkeit (77 Prozent) und Schutzmöglichkeiten (72 Prozent) hervor.
Aus den Ergebnissen lässt sich ein klarer Wunsch nach mehr Aufklärung und Prävention ableiten. „Das sollten gerade Bars, Clubs und Diskotheken nutzen, um sich durch eine gute Aufklärungs- und Präventionsstrategie einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Zeiten, in denen man dachte, das Risiko für Drink Spiking sei in einer Location höher, nur weil hier davor gewarnt wird, sind sicherlich vorbei”, fasst die Betriebswirtschaftlerin Förster zusammen.
Die gemeinsame anonyme Online-Umfrage der Juniorprofessur Europäisches Management der TU Chemnitz und des Kompetenzzentrums Gewaltschutz der Tirol Kliniken in Innsbruck wird fortgeführt. Die Erhebung richtet sich an Personen ab 14 Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bisher sind mehr als 2.500 Rückmeldungen eingegangen. „Wir hoffen weiterhin auf eine Förderung und freuen uns sehr über die Unterstützung, die wir bereits erhalten, zum Beispiel von der international agierenden Marketingagentur Saatchi & Saatchi sowie durch das Frauennetzwerk IVY Female Collective“, ergänzt Förster.
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Jun.- Prof. Dr. Charlotte Förster, Telefon +49 (0)371 531-36855, E-Mail charlotte.foerster@wiwi.tu-chemnitz.de
Weitere Informationen:
https://www.do-not-knock-me-out.com – Weitere Informationen zum Forschungsprojekt „Don’t knock me out“ und zum Thema K.O.-Tropfen
Bilder
Motiv der Edgar-Freecard-Kampagne zur Verbreitung der K.O.-Tropfen-Studie per Gratispostkarten.
Copyright: Design: Saatchi & Saatchi
Merkmale dieser Pressemitteilung:
Journalisten, Lehrer/Schüler, Studierende, Wirtschaftsvertreter, Wissenschaftler
Gesellschaft, Medizin, Psychologie, Recht, Wirtschaft
überregional
Forschungsergebnisse, Forschungsprojekte
Deutsch