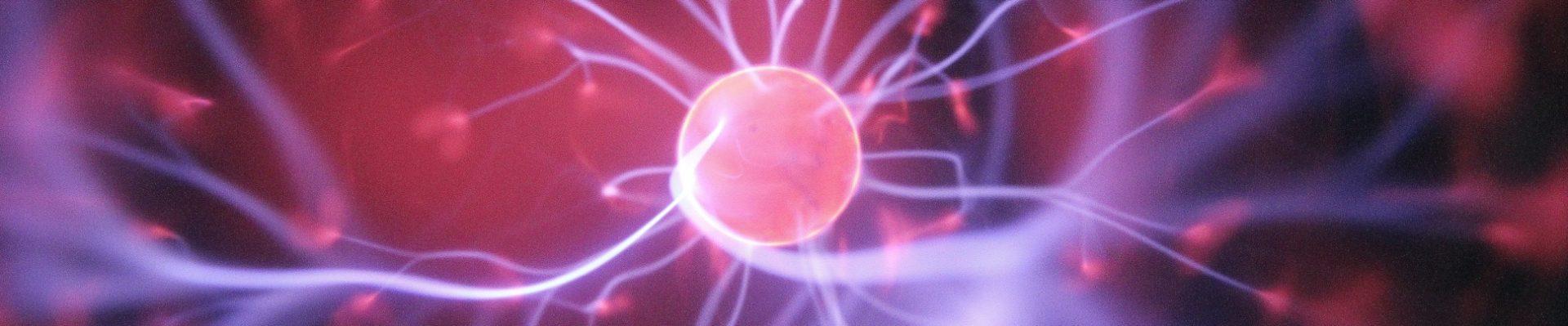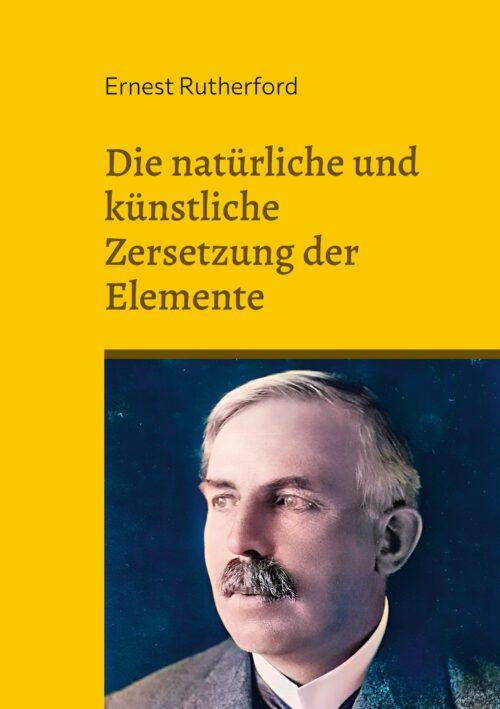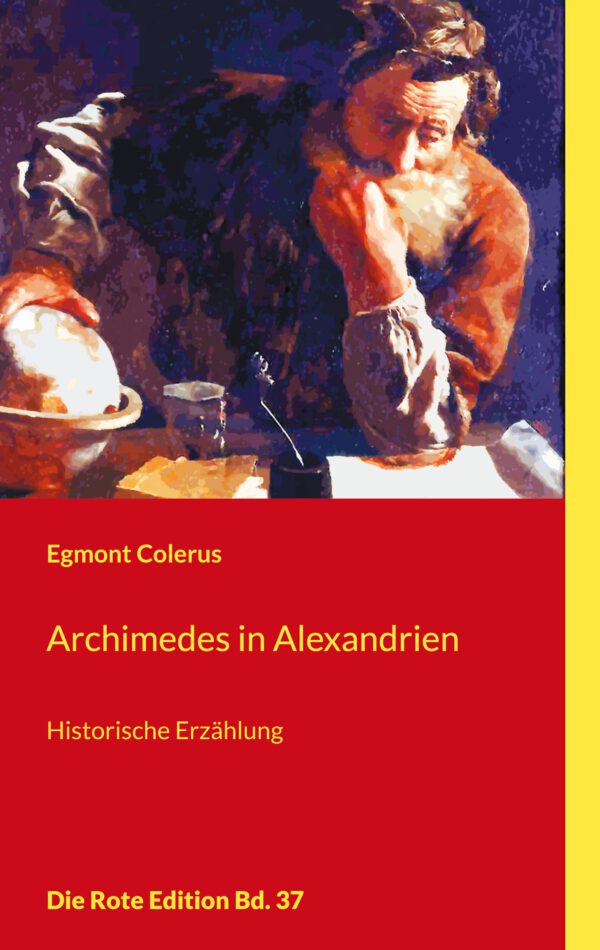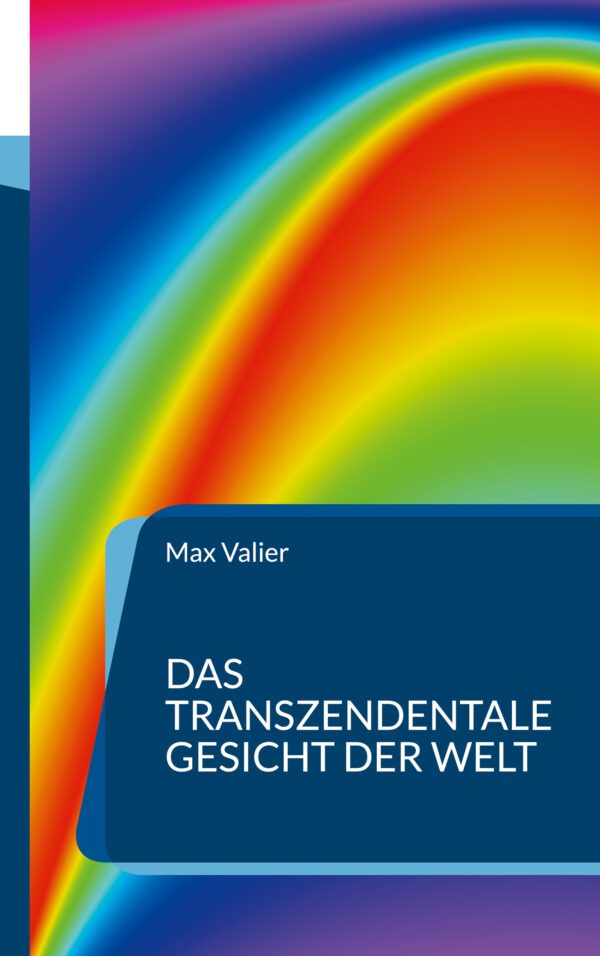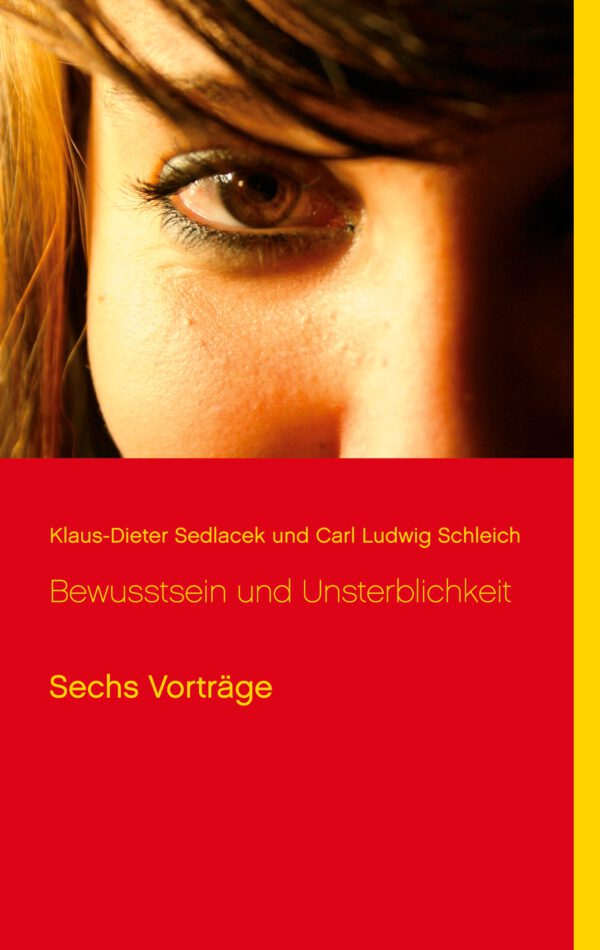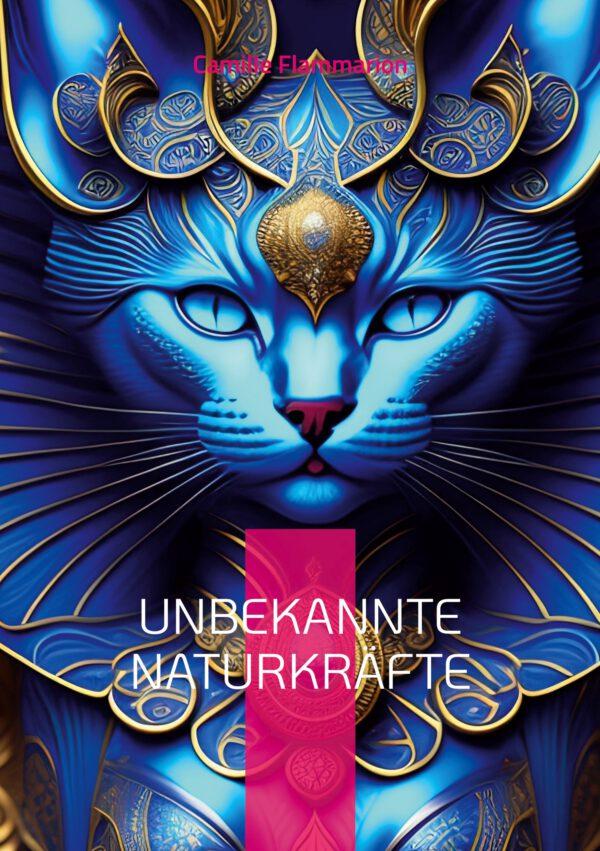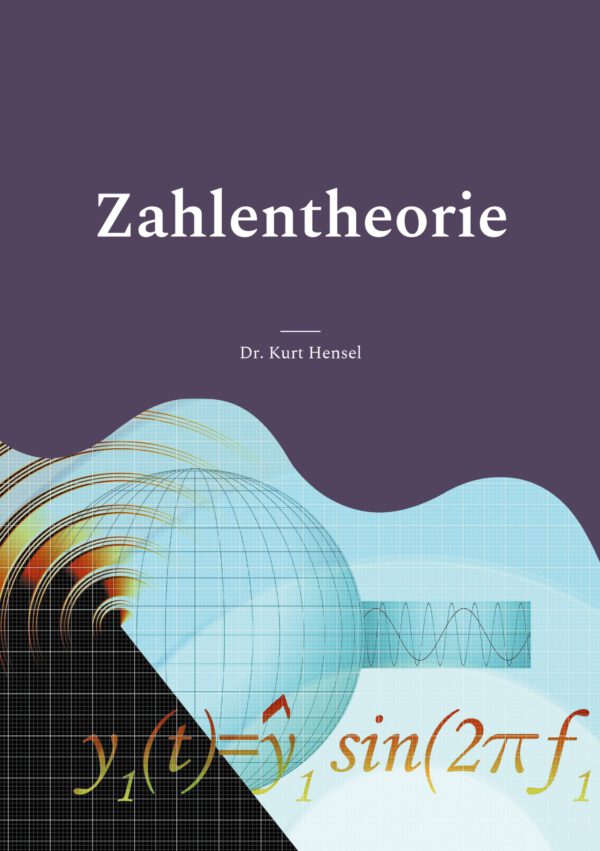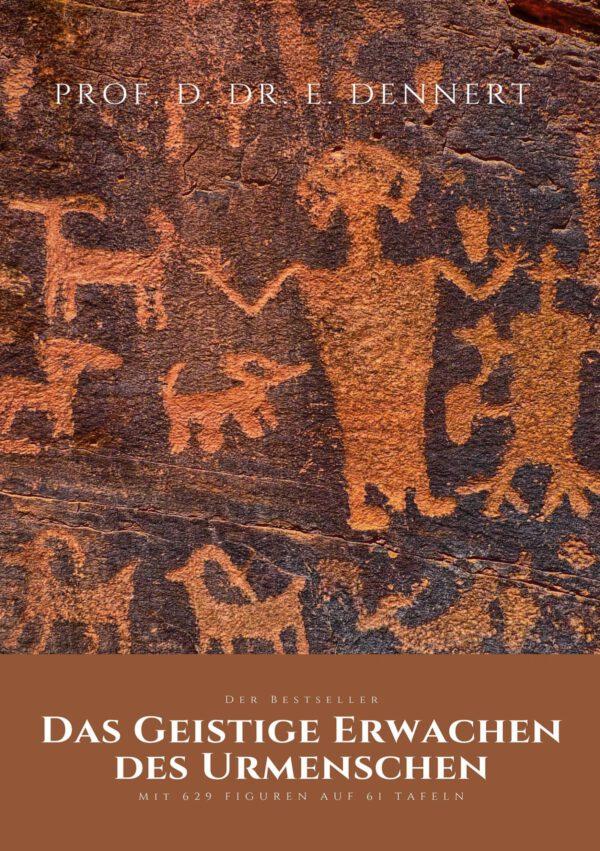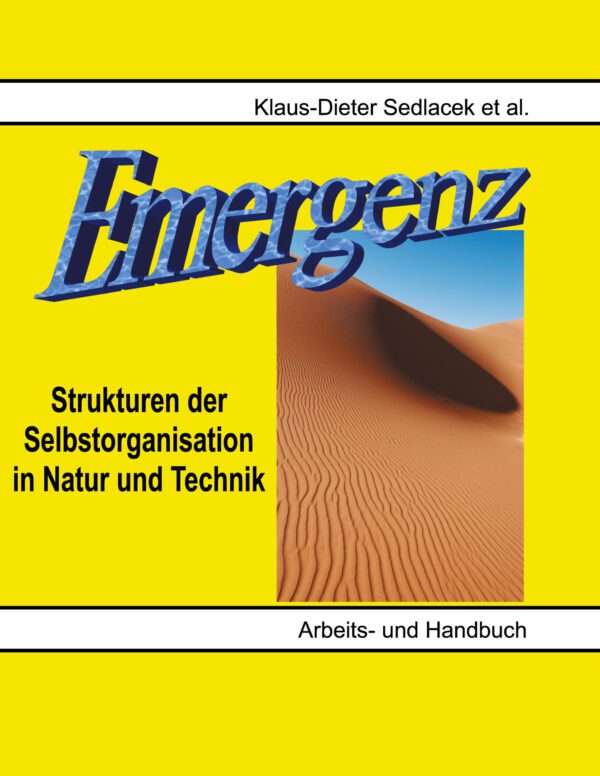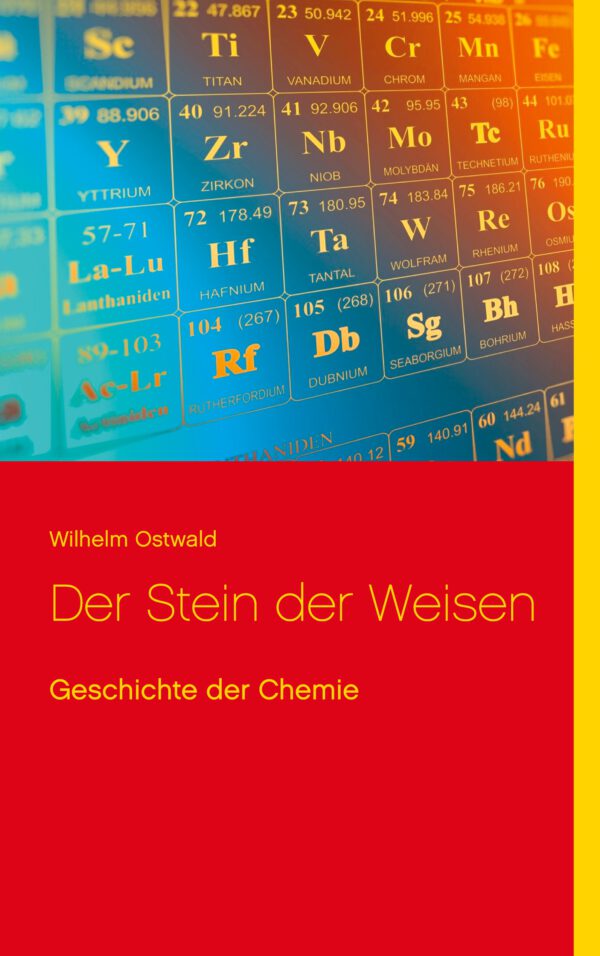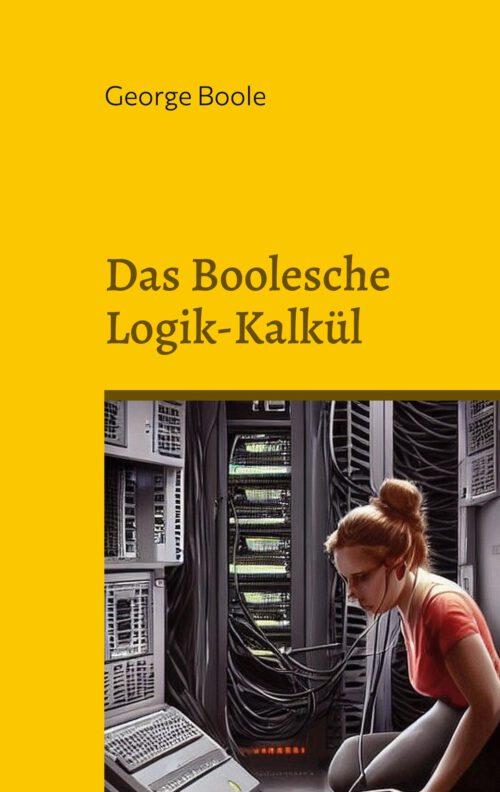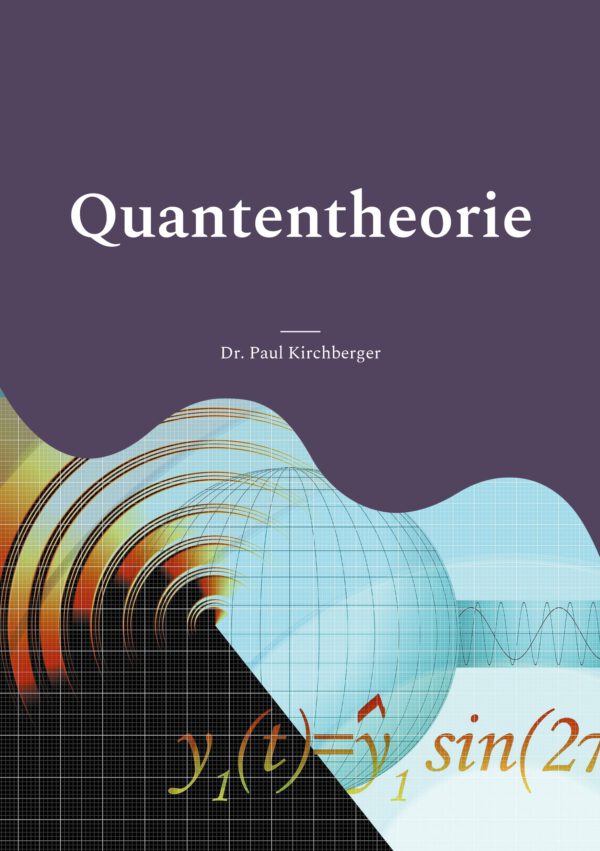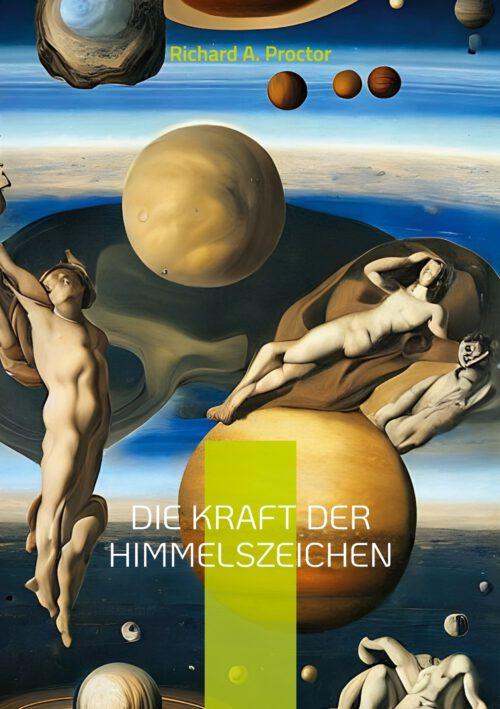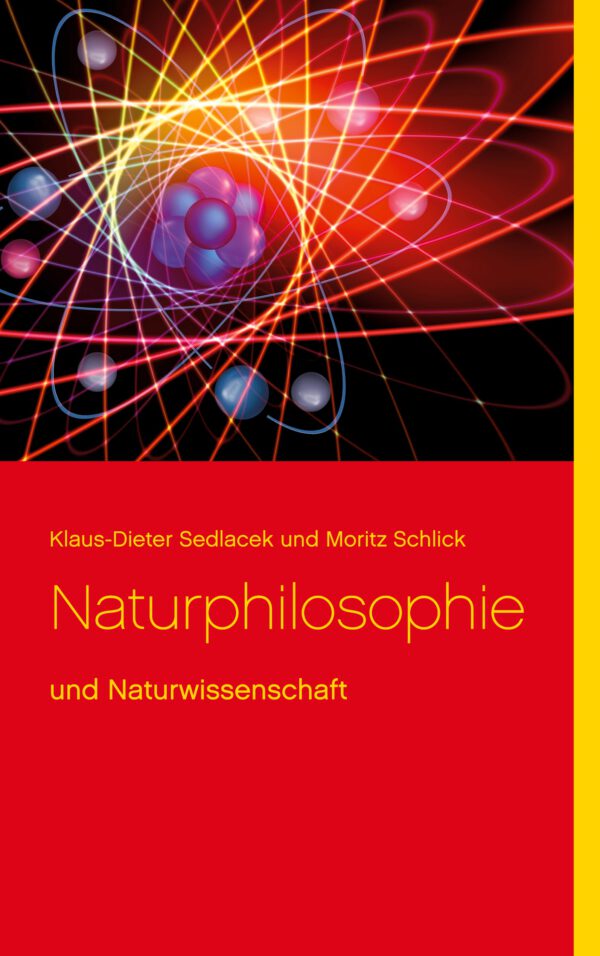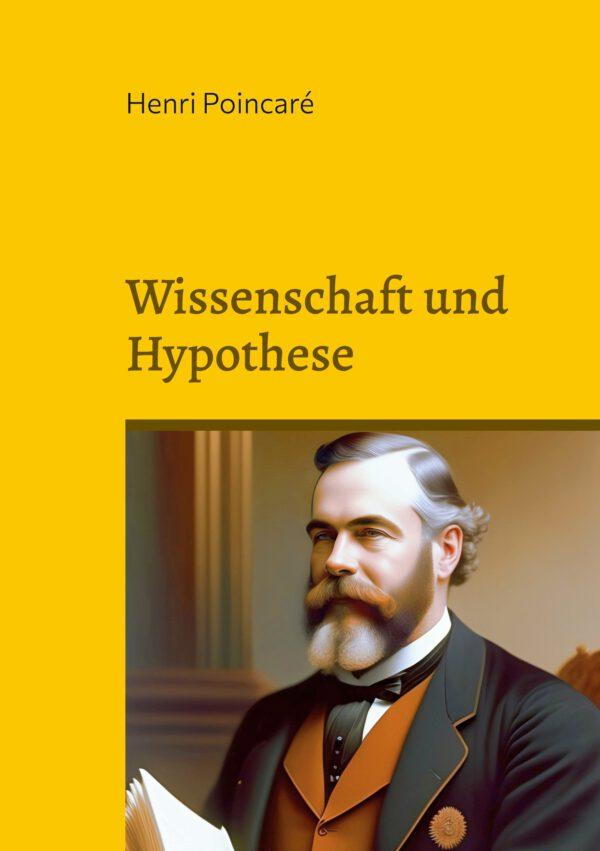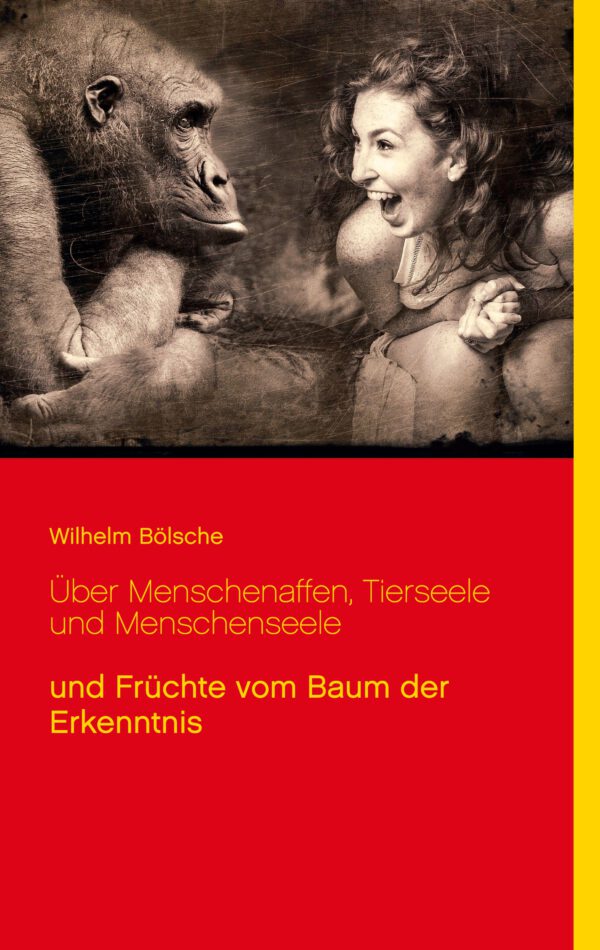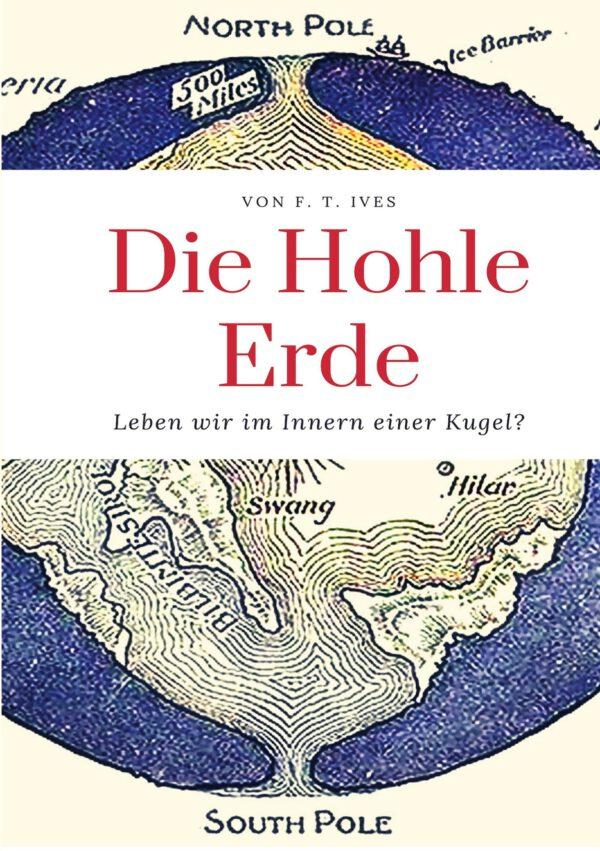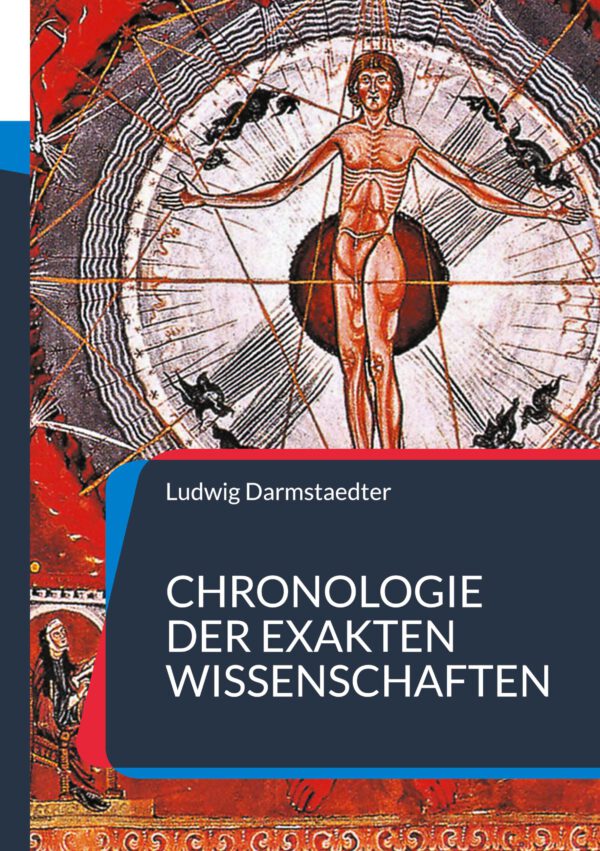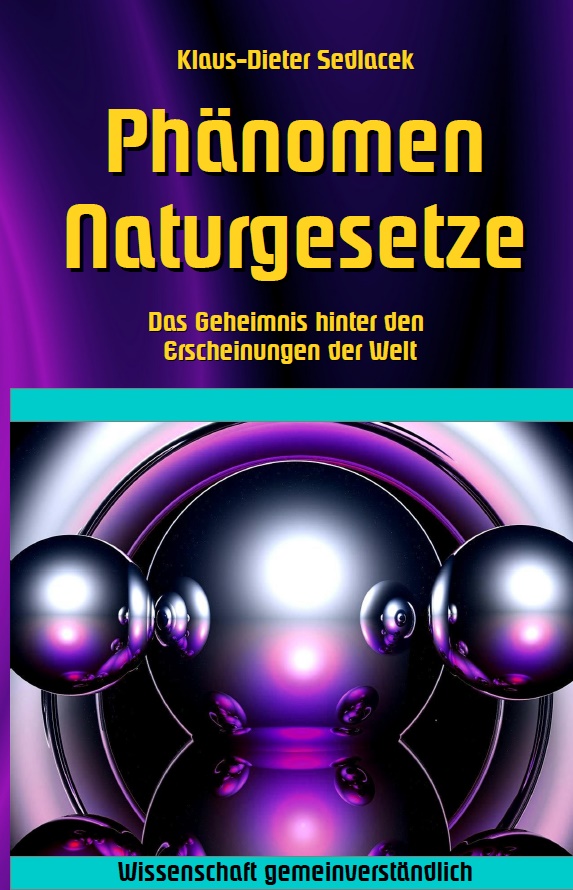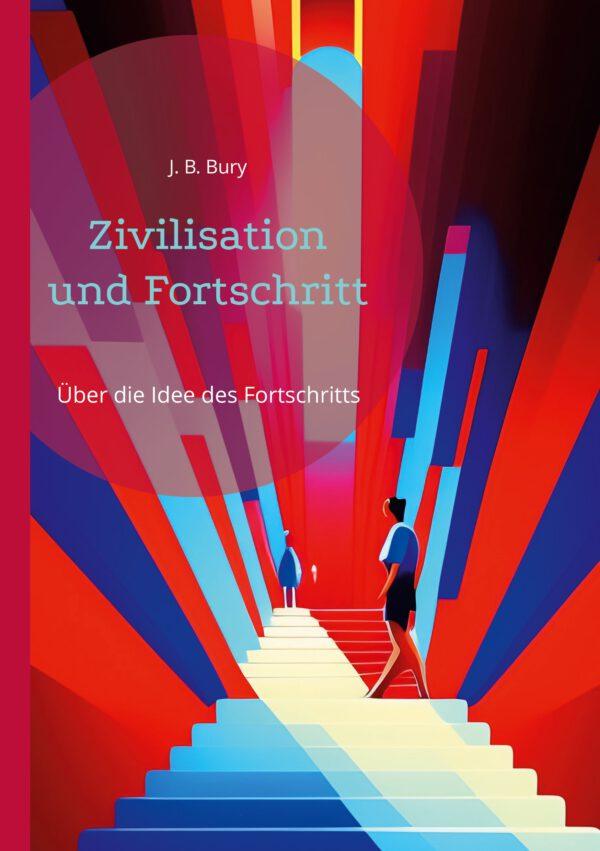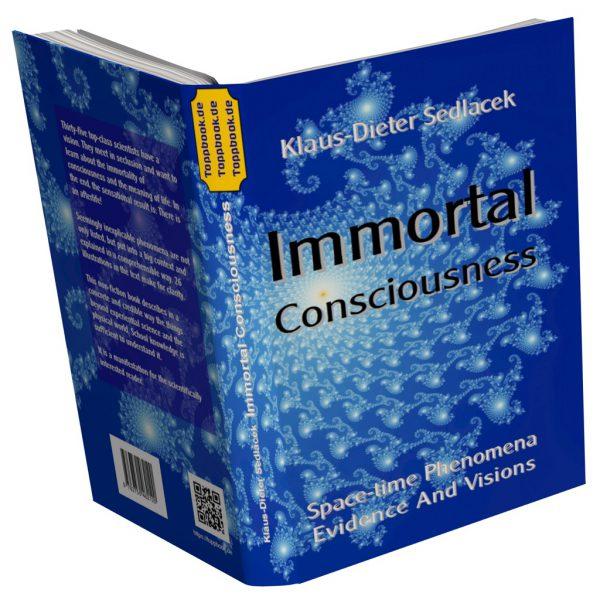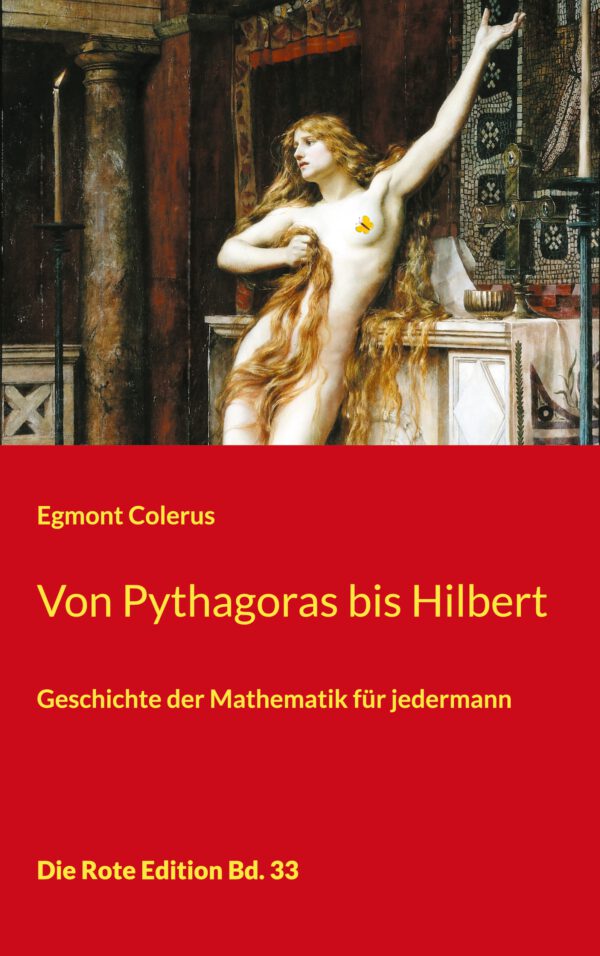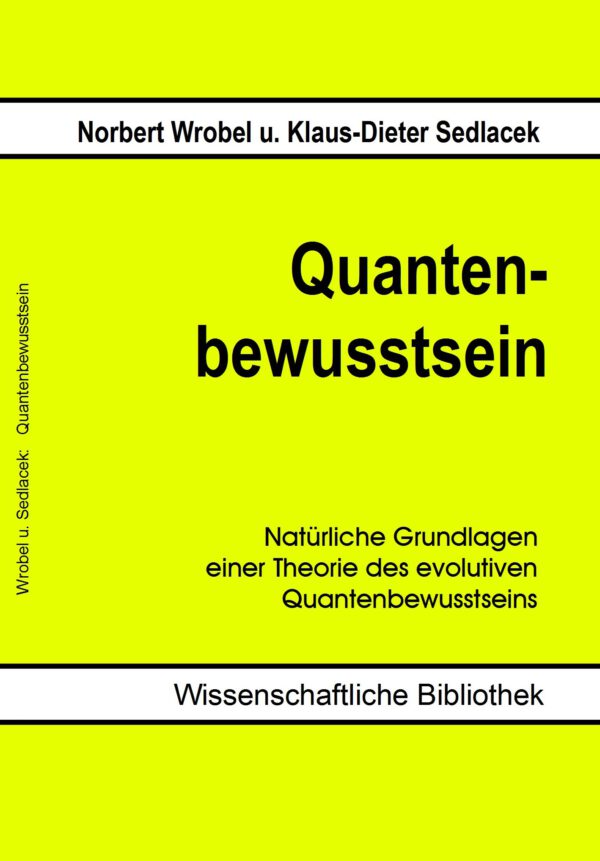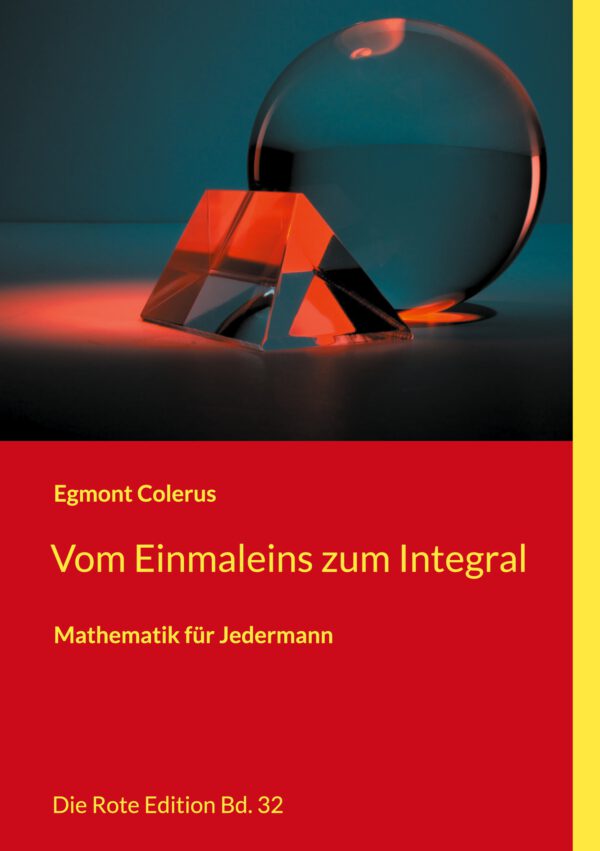19.02.2020 09:47
DGPM: Trotz belastender Entbindung positiv in die nächste Schwangerschaft
Die Geburt eines Kindes ist ein einschneidendes Erlebnis – und nicht immer positiv: Rund vier Prozent der Mütter entwickeln nach der Entbindung Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), leiden also etwa unter sehr negativen Stimmungen oder durchleben die traumatische Situation immer wieder. Solche Probleme können die Entscheidung für ein weiteres Kind verzögern oder gar verhindern.
Eine aktuelle Studie nimmt den betroffenen Frauen nun jedoch eine Sorge: Wenn sie sich für eine erneute Schwangerschaft entscheiden, scheint diese von den negativen Erfahrungen nicht belastet zu sein – die mütterliche Bindung an das Ungeborene erwies sich in der Studie sogar als stärker als bei Frauen, die noch nie posttraumatische Symptome erlebt hatten. Die Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (DGPM) nimmt die Untersuchung zum Anlass, jungen Müttern auch nach einer als schwierig erlebten Geburt Mut zu machen, sich für ein weiteres Kind zu entscheiden.
*******************************************************************************************
Plötzlich gesund
Fortschreitende Naturerkenntnis, ganz allgemein gesprochen, ‘Wissenschaft’, ist der stärkste Feind des medizinischen Wunders. Was unseren Vorfahren als Wunder erschien, was einfache Naturvölker heute noch in heftige Erregung versetzt, das berührt den zivilisierten Menschen längst nicht mehr.
Doch es gibt einen Gegensatz, der jedem Denkenden sofort auffällt: der unerhörte, durchaus nicht abgeschlossene Aufstieg der wissenschaftlichen Heilkunde und die ebenso unerhörte Zunahme der Laienbehandlung und der Kurpfuscherei. Man schätzt die Zahl der Menschen, die der Schulmedizin kein Vertrauen schenken, auf immerhin 50 Prozent.
Wie kann es sein, daß Laienbehandler und Kurpfuscher immer wieder spektakuläre Erfolge aufweisen, von denen die Sensationspresse berichtet?
Der Autor geht dieser Frage nach und kommt zu interessanten Erkenntnissen, aus denen er Vorschläge für eine bessere Krankenbehandlung durch seine ärztlichen Standesgenossen ableitet.
Schon lange vor der Geburt stellt sich bei der werdenden Mutter in der Regel das Gefühl ein, nicht mehr nur allein für sich verantwortlich zu sein. Die Präsenz des kleinen Wesens ist deutlich spürbar, viele Mütter streicheln ihr Ungeborenes durch die Bauchdecke hindurch, ertasten Kopf und Füße, sprechen mit ihm oder singen ihm vor. „Die vorgeburtliche Bindung an das Kind gilt als wichtiger Faktor dafür, wie Schwangerschaft und Geburt verlaufen“, sagt PD Dr. habil. Susan Garthus-Niegel, Leiterin der Forschungsgruppe Epidemiologie und Frauengesundheit an der Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik der TU Dresden. So achten Frauen mit intensiver Bindung an ihr Ungeborenes eher darauf, während der Schwangerschaft einen gesunden Lebensstil einzuhalten, der Zustand ihrer Neugeborenen ist besser und sie entwickeln auch nach der Entbindung eine intensivere Beziehung zu ihrem Kind.
Eine starke Bindung an das Ungeborene ist jedoch nicht selbstverständlich. Aus Studien ist bekannt, dass psychische Risikofaktoren bei der Mutter, wie etwa Depressionen oder Ängste, die Ausbildung der pränatalen Bindung stören können. „Es war daher anzunehmen, dass sich auch eine traumatische Geburtserfahrung auf die pränatale Bindung in einer weiteren Schwangerschaft auswirkt“, sagt Garthus-Niegel, die die nun publizierte Studie zusammen mit ihrer Kollegin Prof. Dr. Antje Horsch leitete.
Im Rahmen der Untersuchung befragten die Dresdner Psychologin und ihre Kolleginnen und Kollegen werdende Mütter in der 17. Schwangerschaftswoche zu früheren Geburtserfahrungen und möglichen posttraumatischen Symptomen. Gegen Ende der Schwangerschaft – in der 34. Woche – wurden die Frauen erneut befragt. Diesmal stand die Bindung zum heranwachsenden Kind im Fokus. Wie stark diese ausgeprägt war, ermittelten die Studienleiterinnen mithilfe eines Fragebogens, auf dem die Mütter unter anderem Angaben dazu machten, wie häufig sie ihr Baby durch die Bauchdecke streichelten, von ihm träumten, Liebe empfanden oder sich sein Aussehen vorstellten. Auch sollten sie angeben, ob sie glaubten, ihr Baby habe schon eine Persönlichkeit.
Wie die Auswertung ergab, hatten Frauen mit Anzeichen für eine frühere PTBS eine stärkere Bindung an ihr Kind als Frauen mit niedrigen Belastungswerten. „Dieses Ergebnis hat uns überrascht“, berichtet Garthus-Niegel. Es gebe jedoch einige mögliche Erklärungen. So sei es etwa denkbar, dass Frauen, die bei einer vorangegangenen Geburt Angst um das Leben ihres Kindes gehabt hätten, sich nun besonders protektiv verhielten. Auch könne die ausgesprochen positive Einstellung zur neuen Schwangerschaft die Möglichkeit bieten, die belastenden Vorkommnisse zu „heilen“.
Als Störfaktor für die Ausbildung einer starken pränatalen Bindung wirkte sich dagegen eine ausgeprägte Angst vor der Geburt aus – die ebenfalls Folge einer traumatischen Geburtserfahrung sein kann. Dennoch sollten solche negativen Erlebnisse der Entscheidung für ein weiteres Kind keinesfalls im Wege stehen, sagt Prof. Dr. med. habil. Kerstin Weidner, Direktorin der Dresdner Klinik. In diesem Zusammenhang sei es auch wichtig, die betroffenen Mütter dazu zu ermutigen, bei der Bewältigung ihres Traumas professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn das geschehe in aller Regel nicht: Die meisten Geburtstraumata blieben unentdeckt und somit auch unbehandelt, so die Expertin der DGPM.
– Bei Abdruck Beleg erbeten –
Quelle:
S. Garthus-Niegel et.al.: Posttraumatic stress symptoms following childbirth: associations with prenatal attachment in subsequent pregnancies. November 2019.
URL: https://doi.org/10.1007/s00737-019-01011-0
*******************************************************************************************
Pressekontakt für Rückfragen:
Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM)
Pressestelle
Janina Wetzstein
Postfach 30 11 20, 70451 Stuttgart
Tel.: 0711 8931-457; Fax: 0711 8931-167
wetzstein@medizinkommunikation.org
http://www.dgpm.de
Weitere Informationen:
http://www.dgpm.de
https://doi.org/10.1007/s00737-019-01011-0
Merkmale dieser Pressemitteilung:
Journalisten
Gesellschaft, Medizin, Psychologie
überregional
Buntes aus der Wissenschaft, Forschungsergebnisse
Deutsch