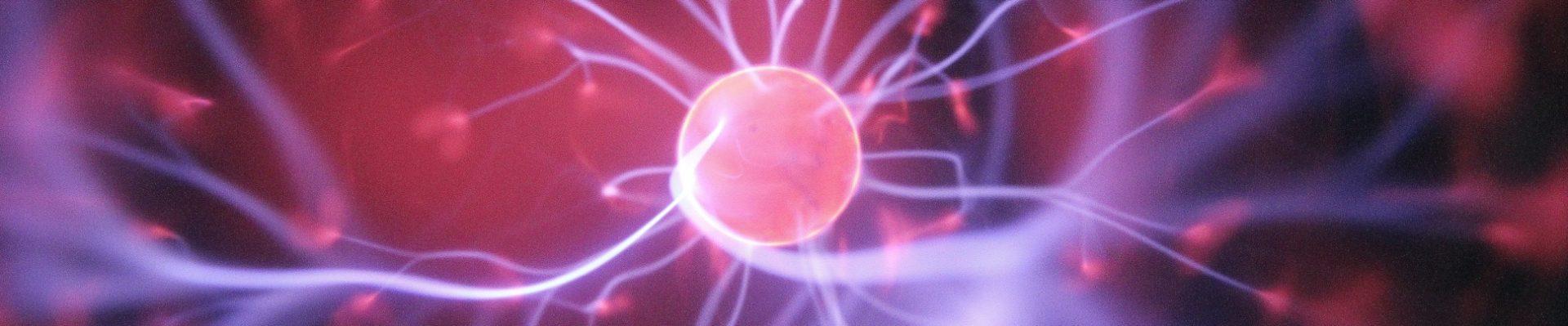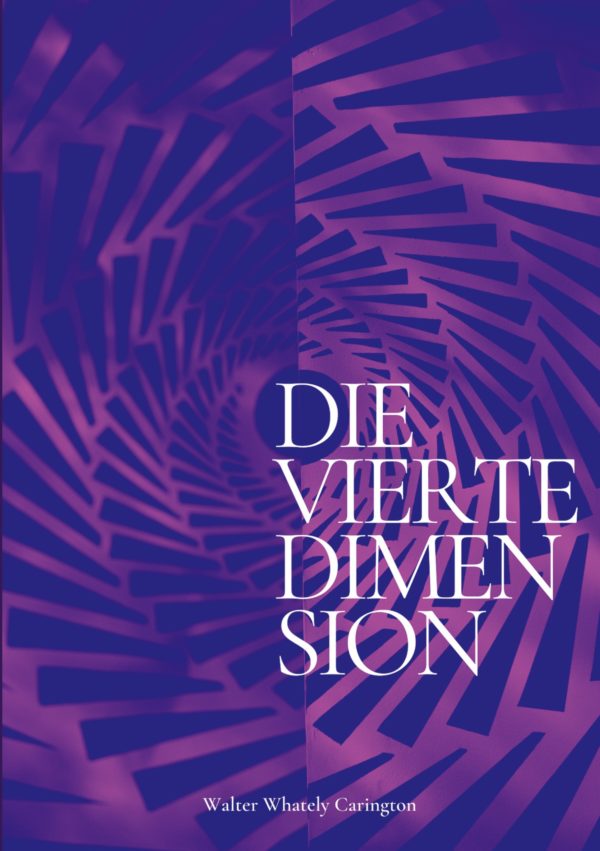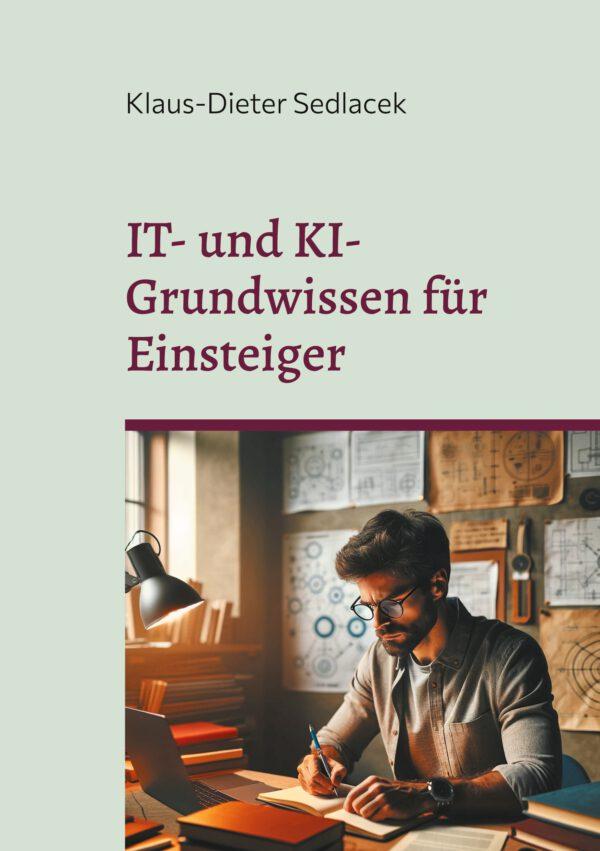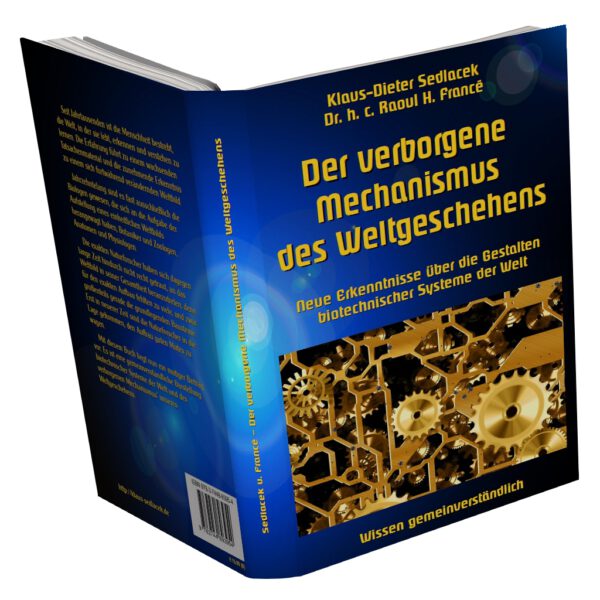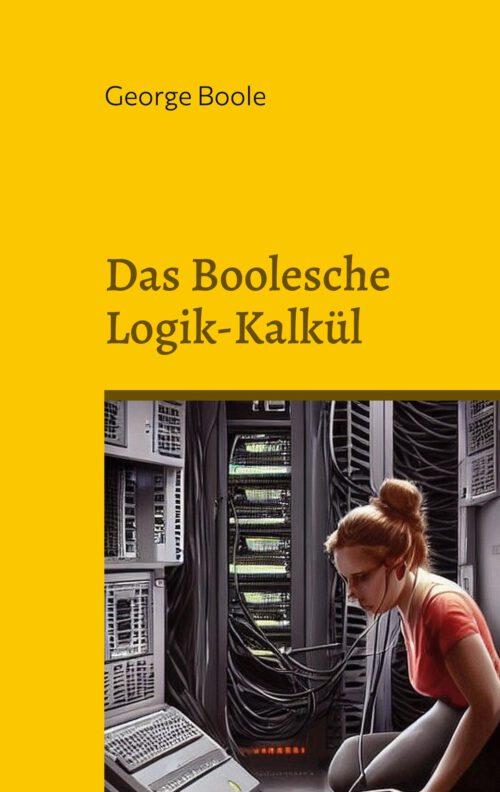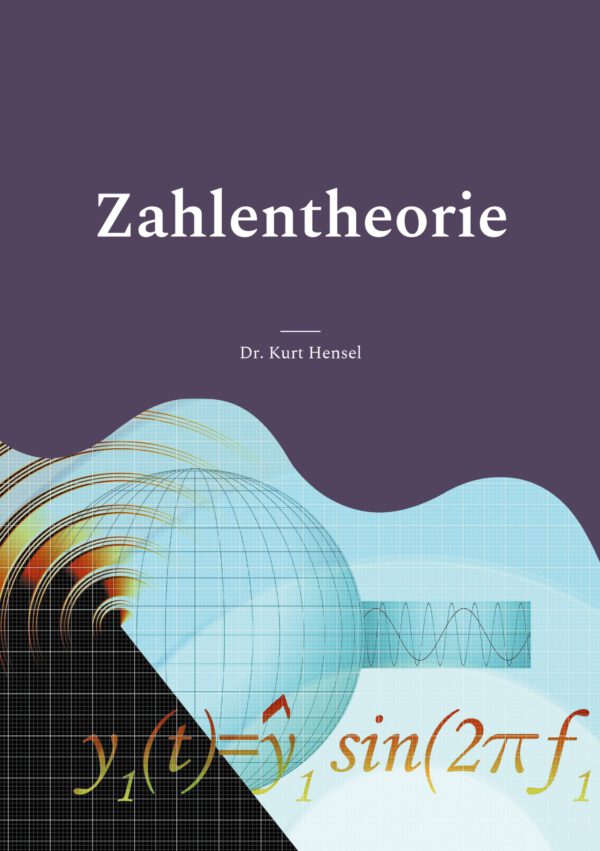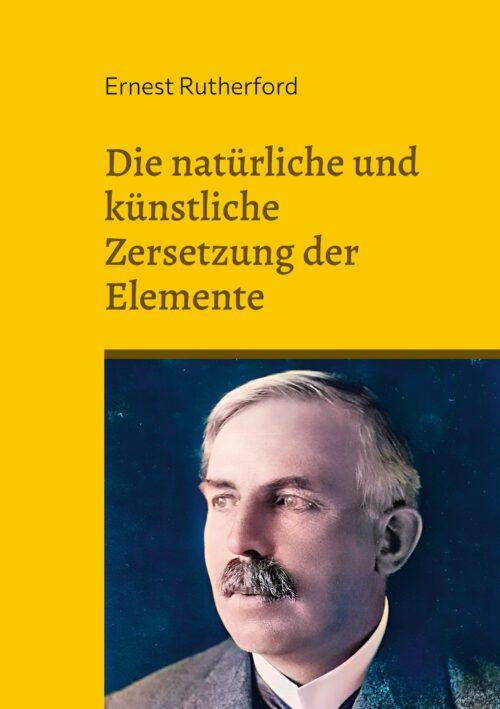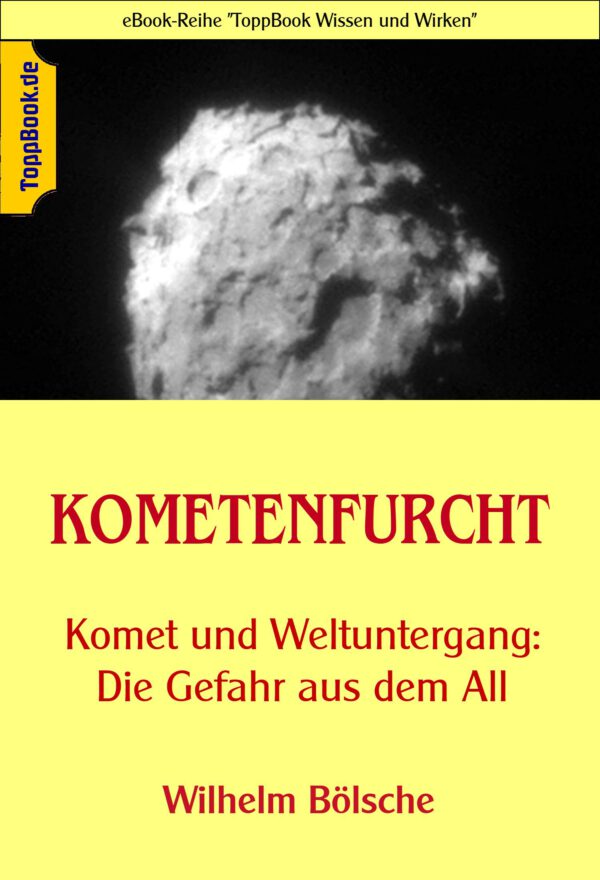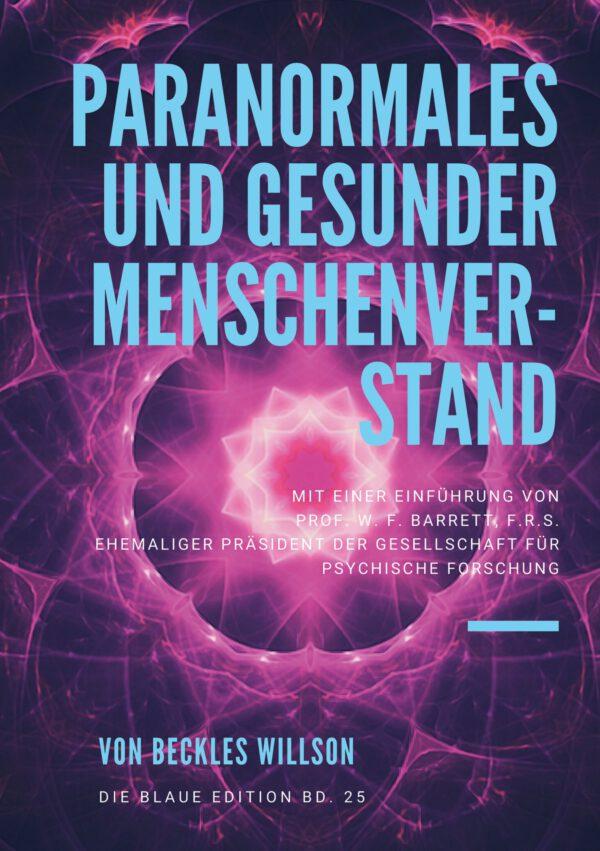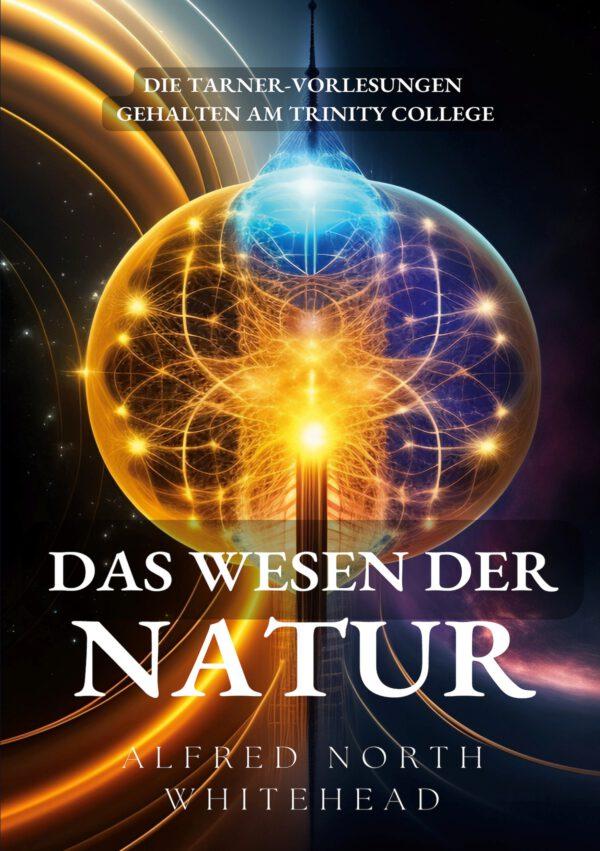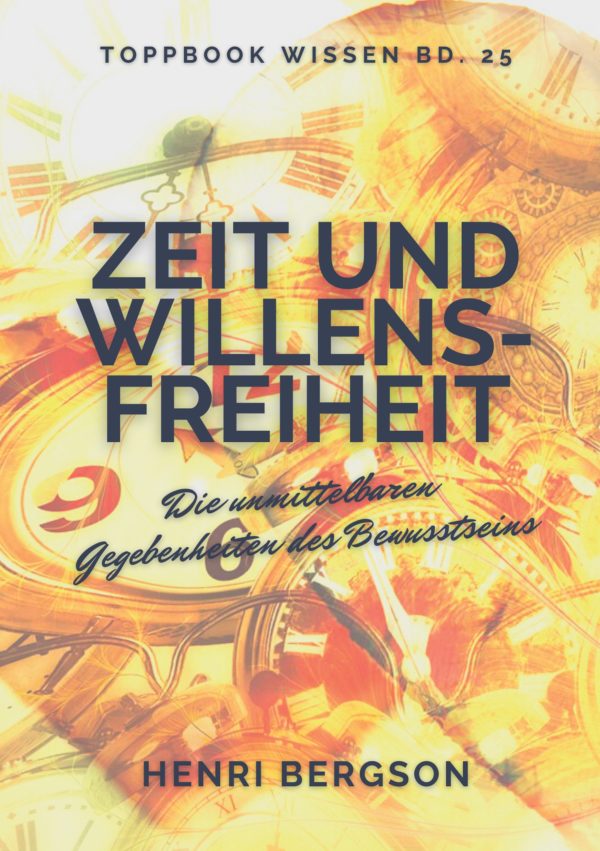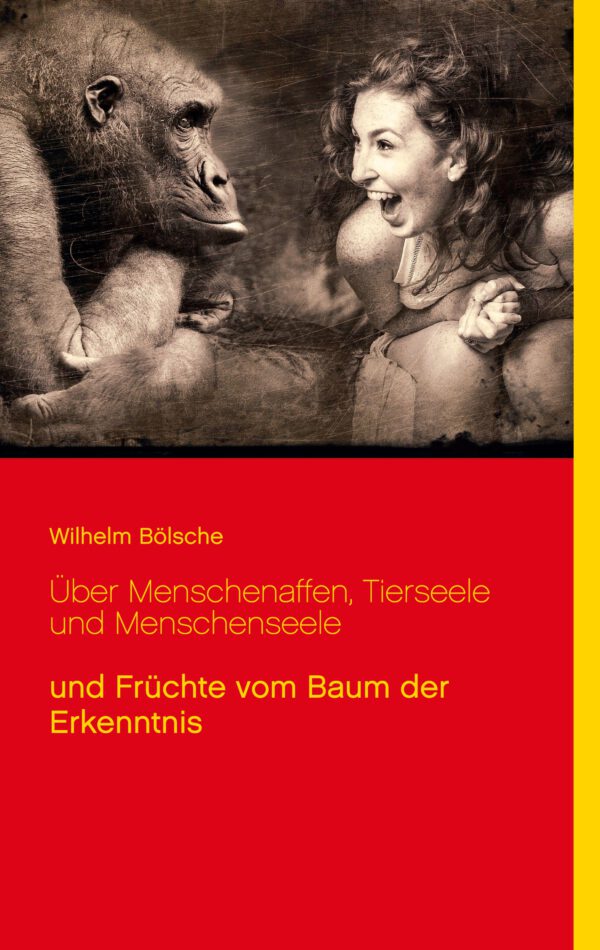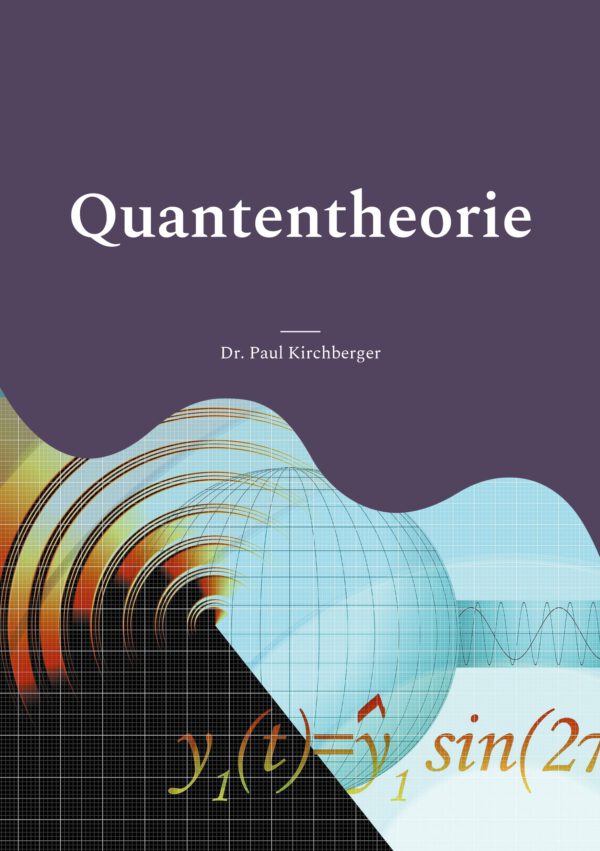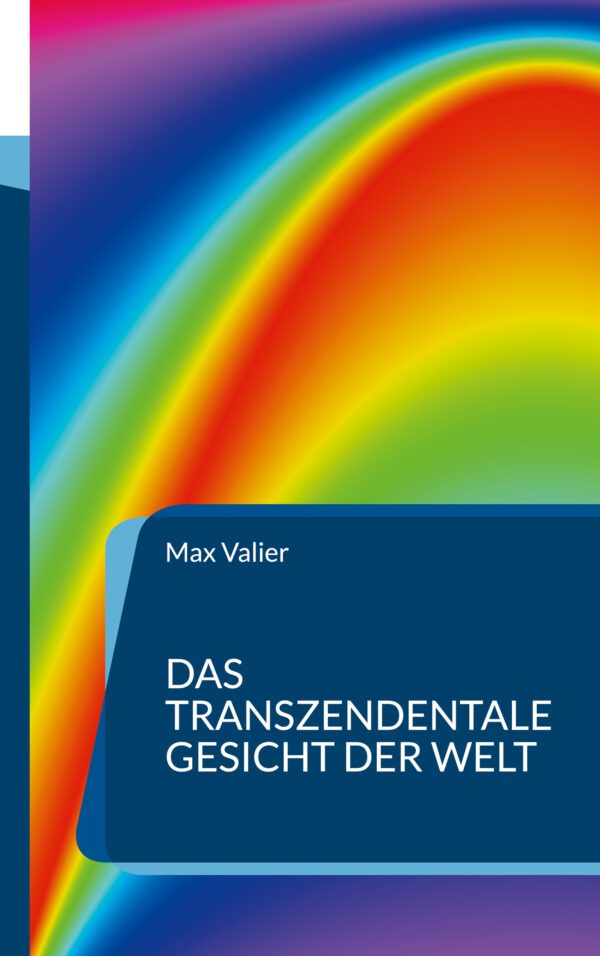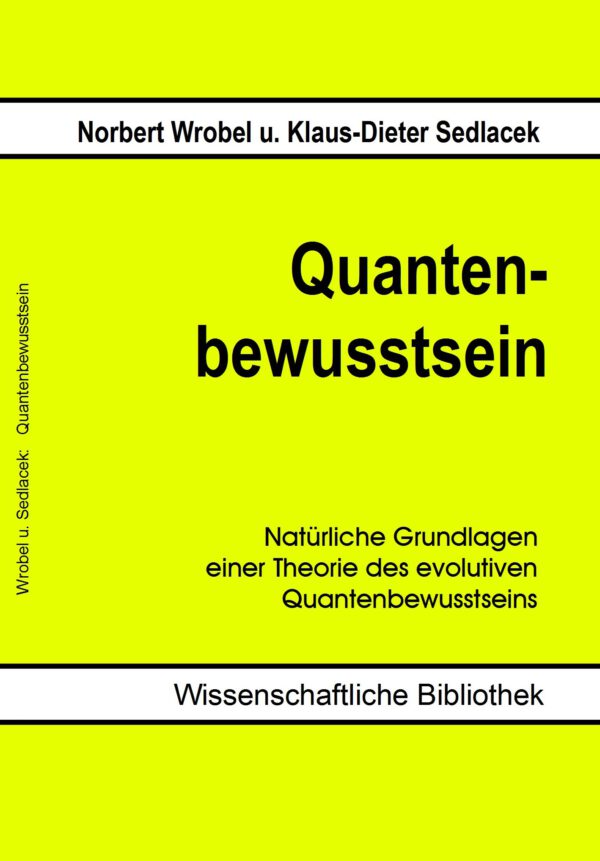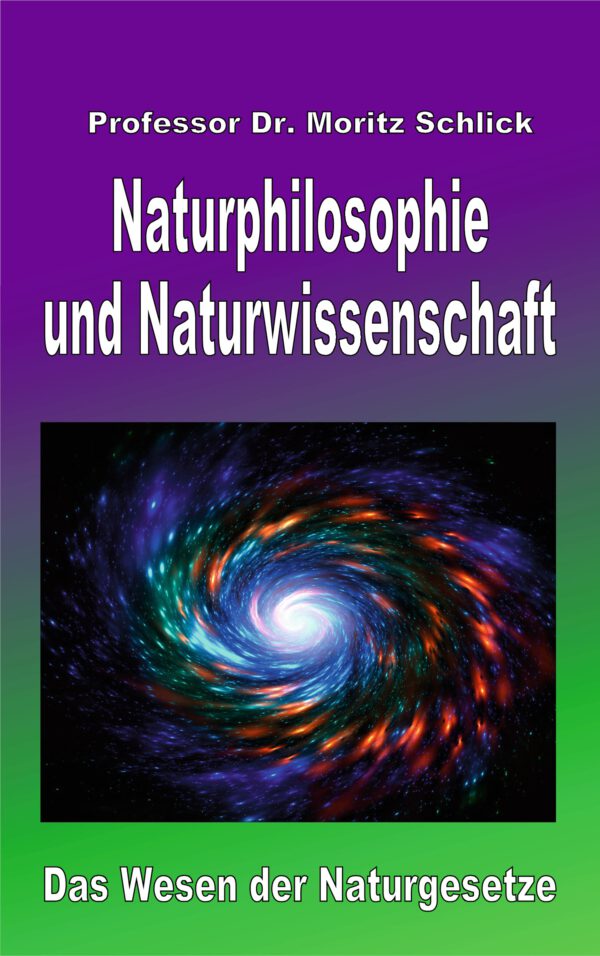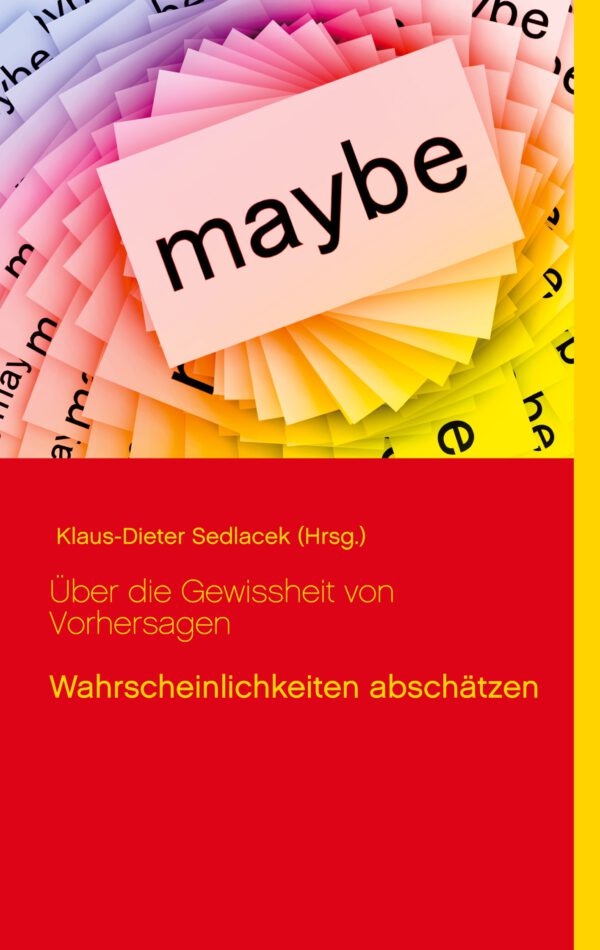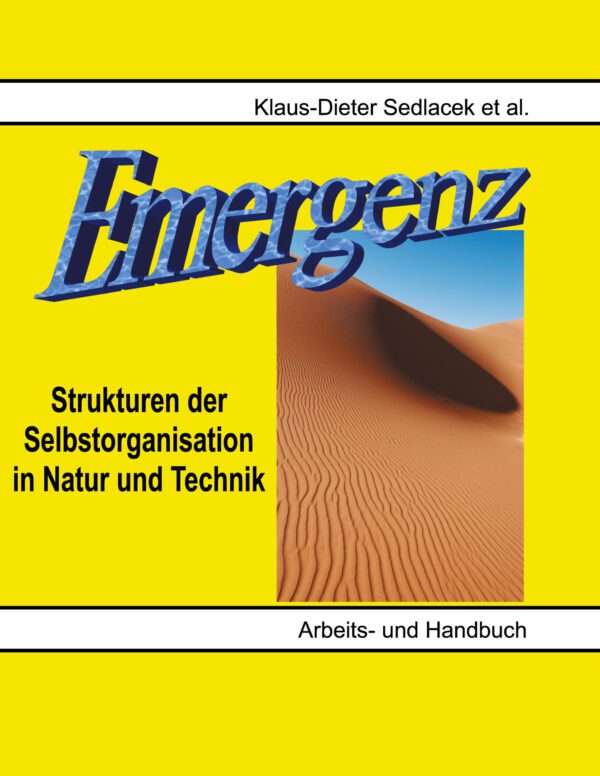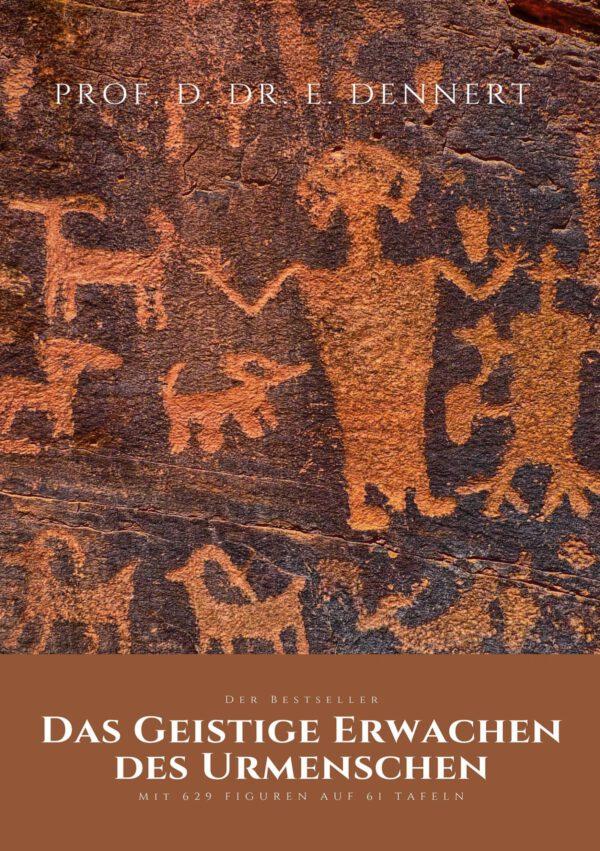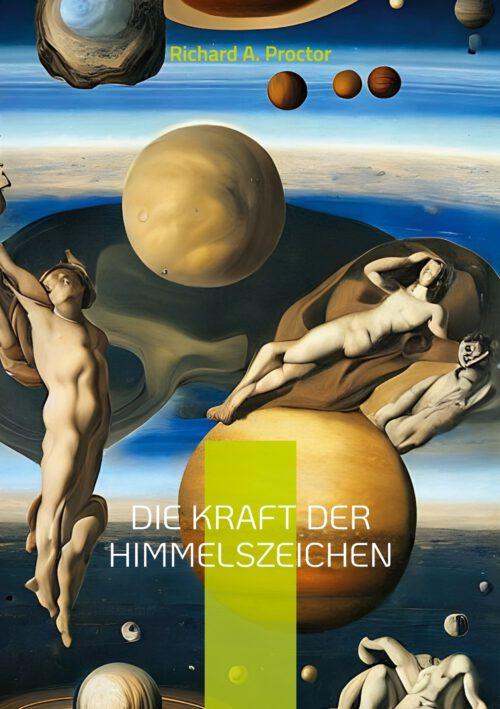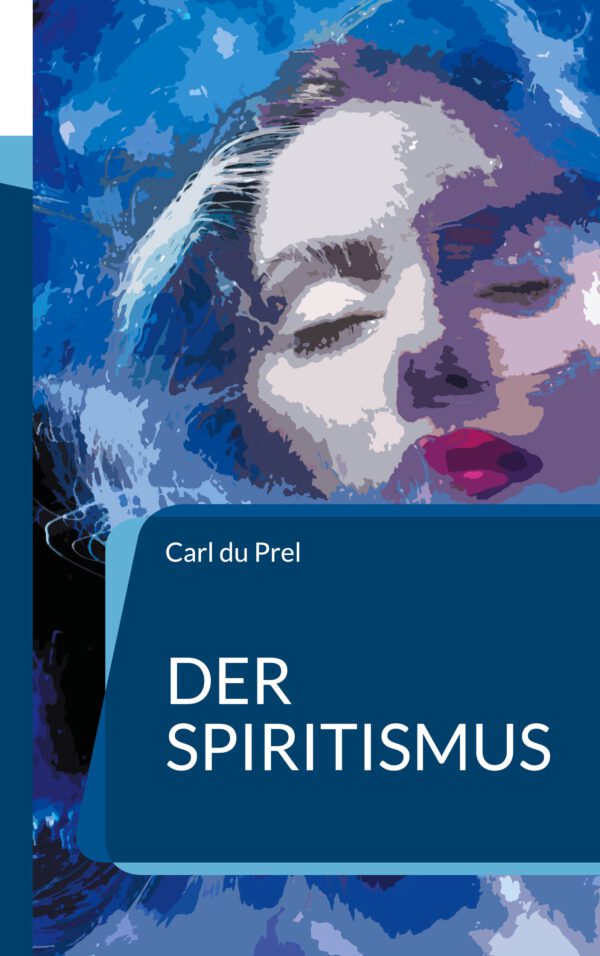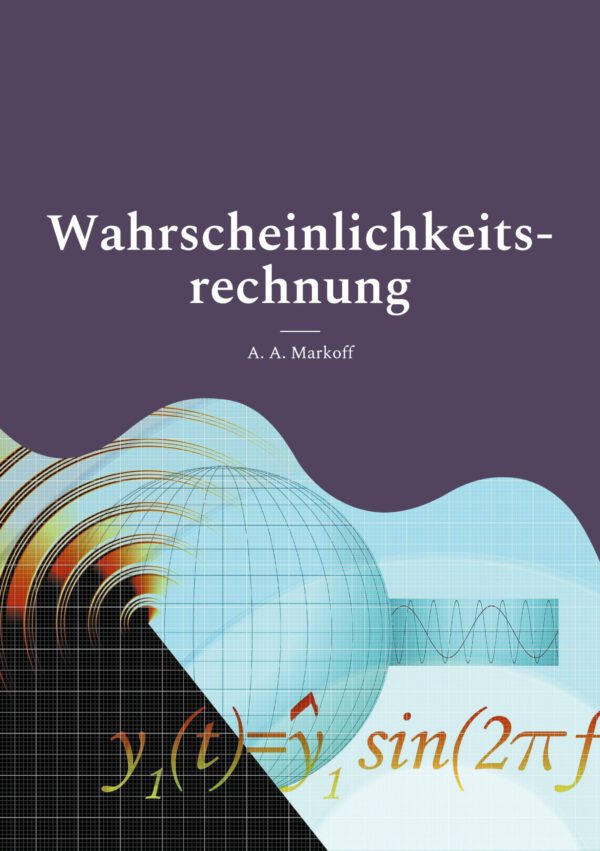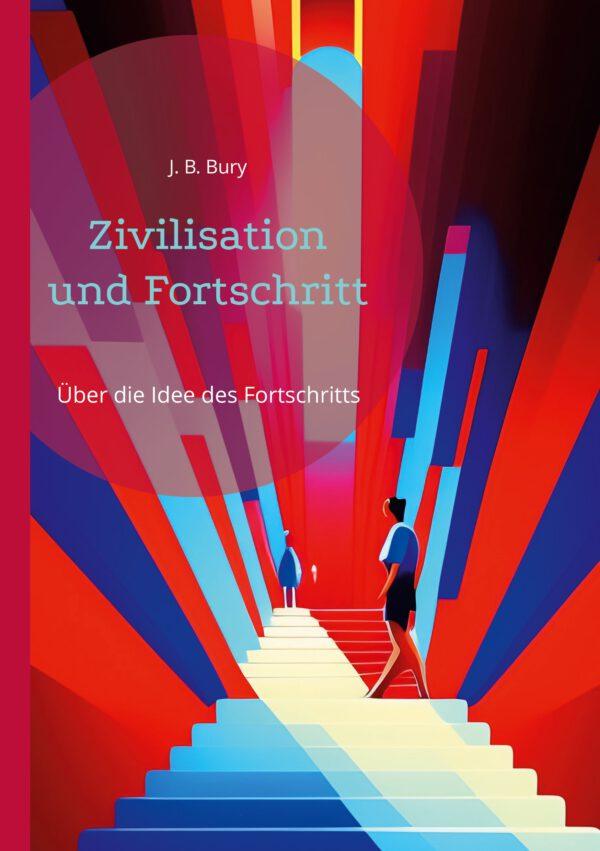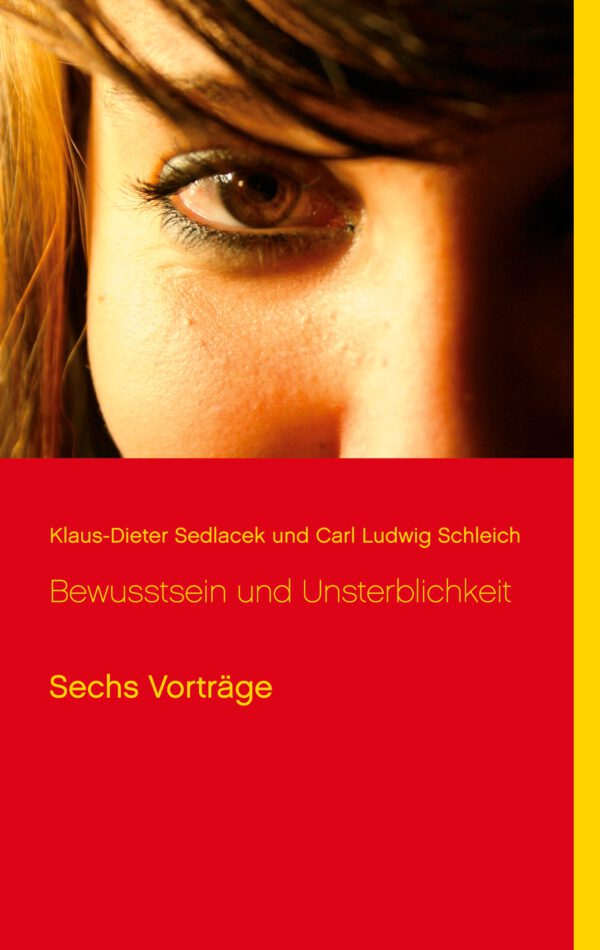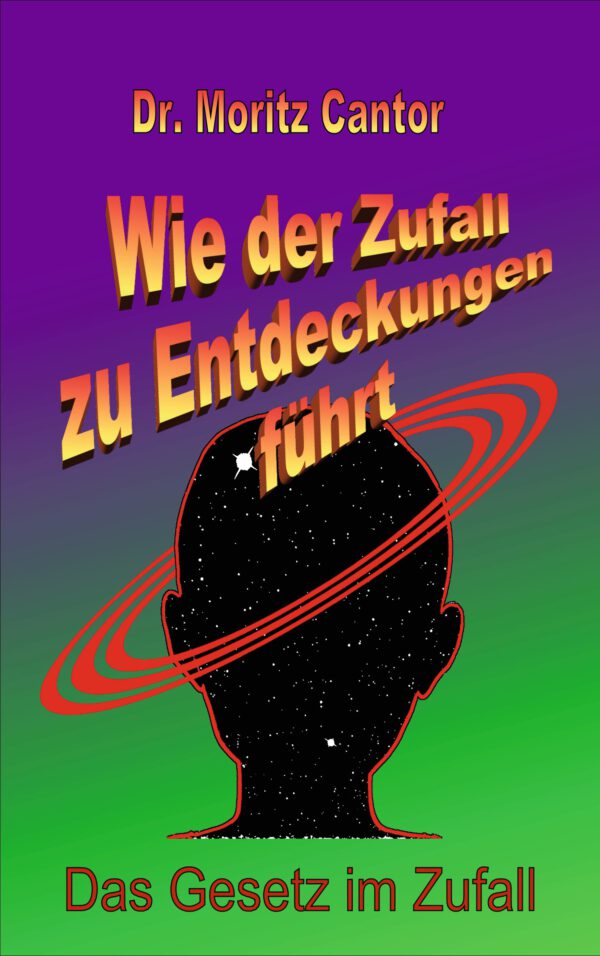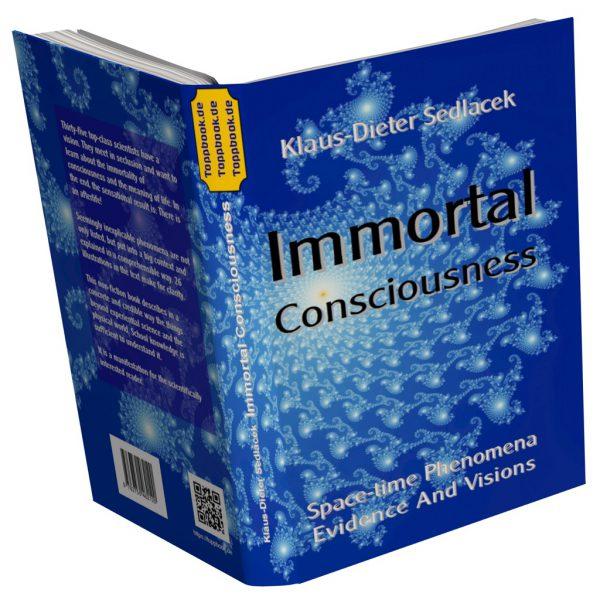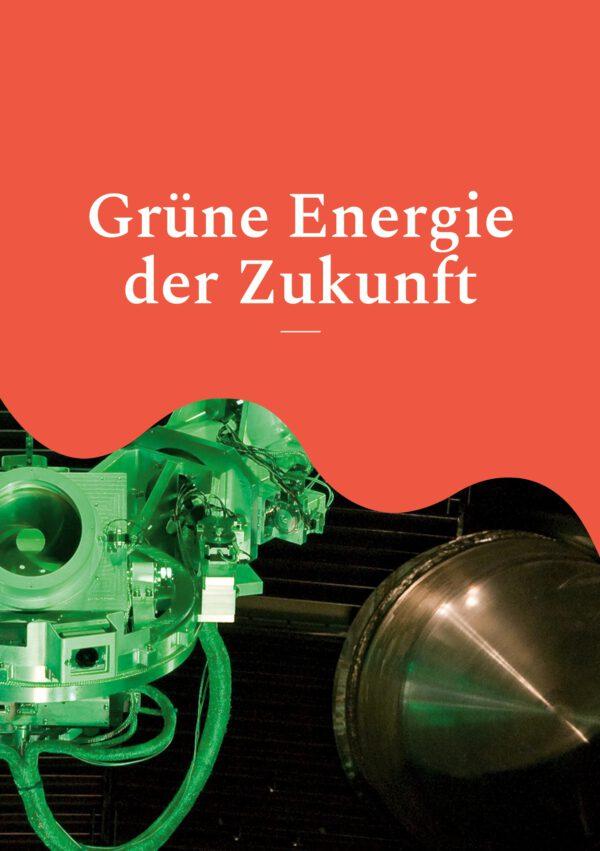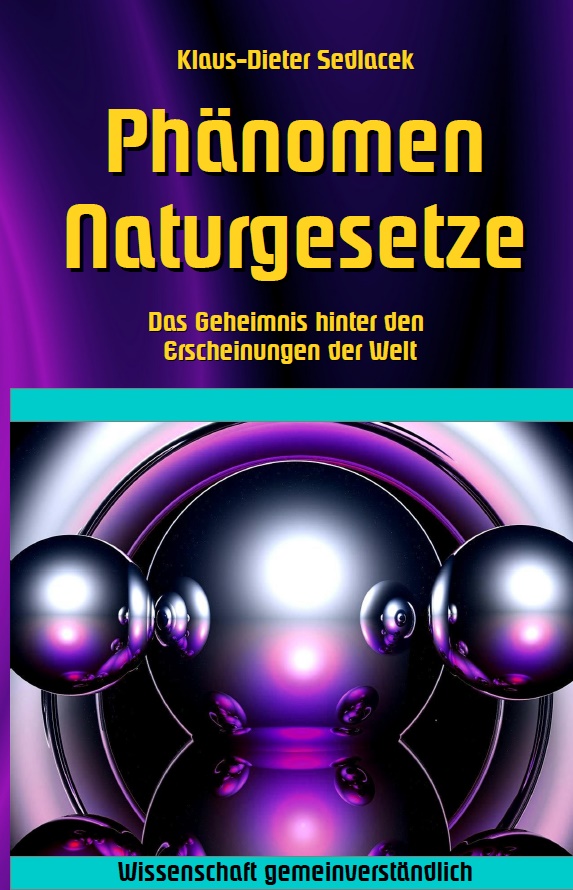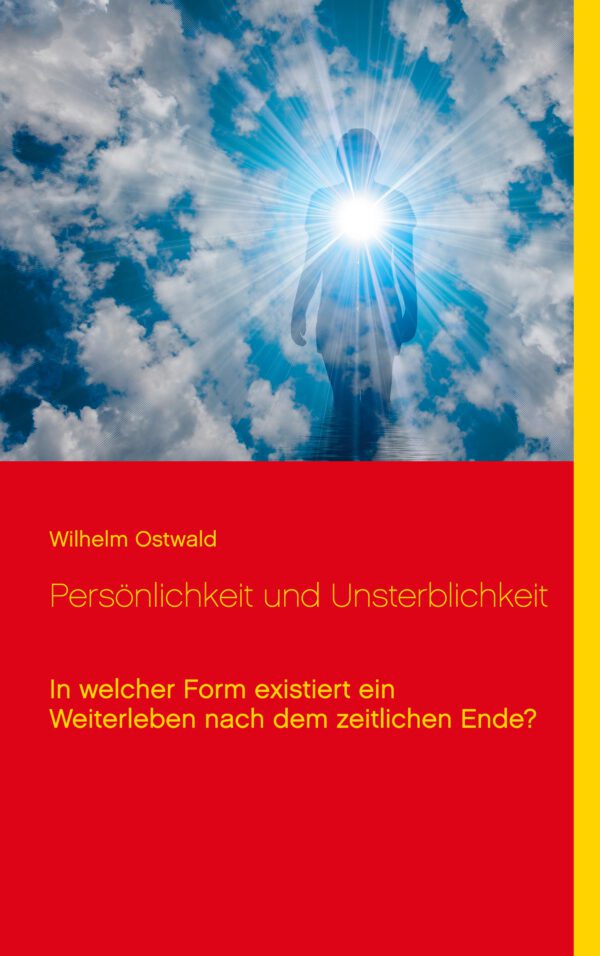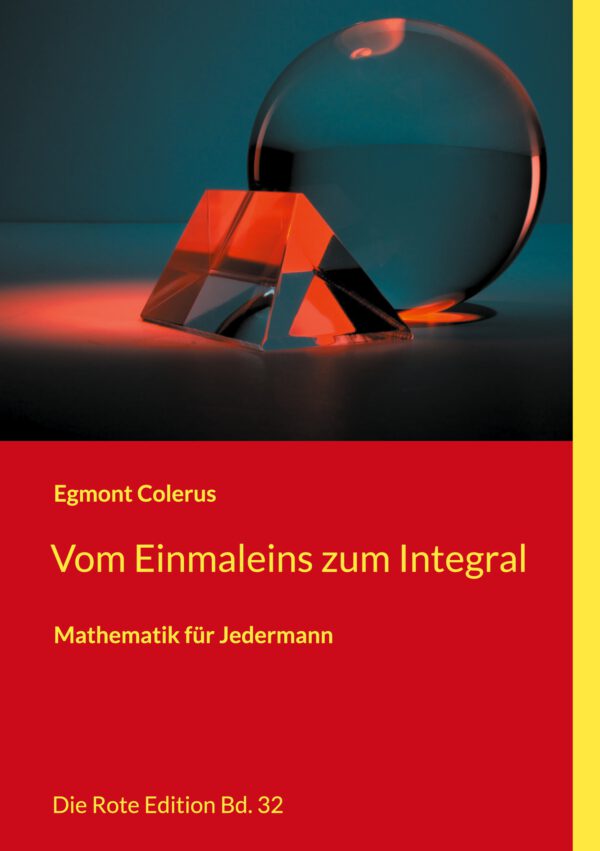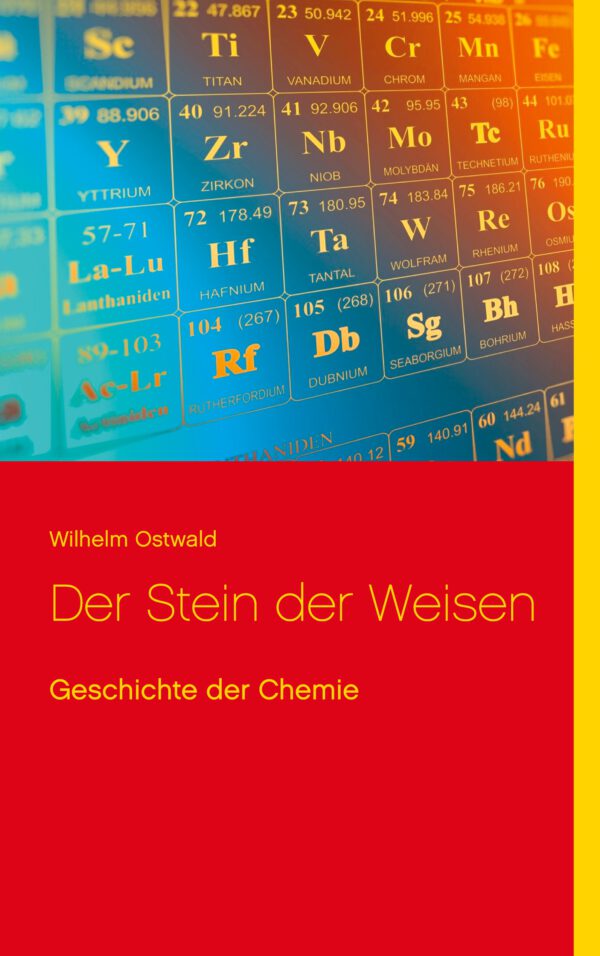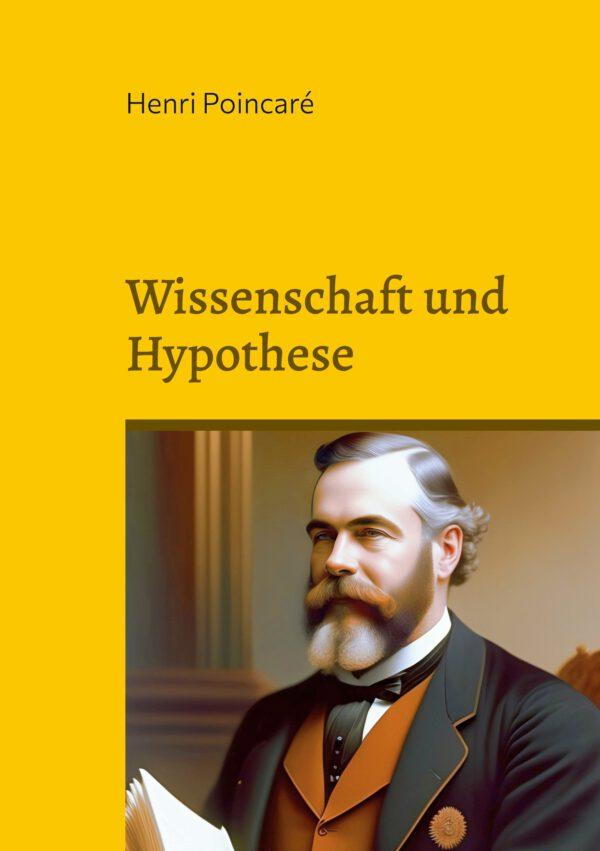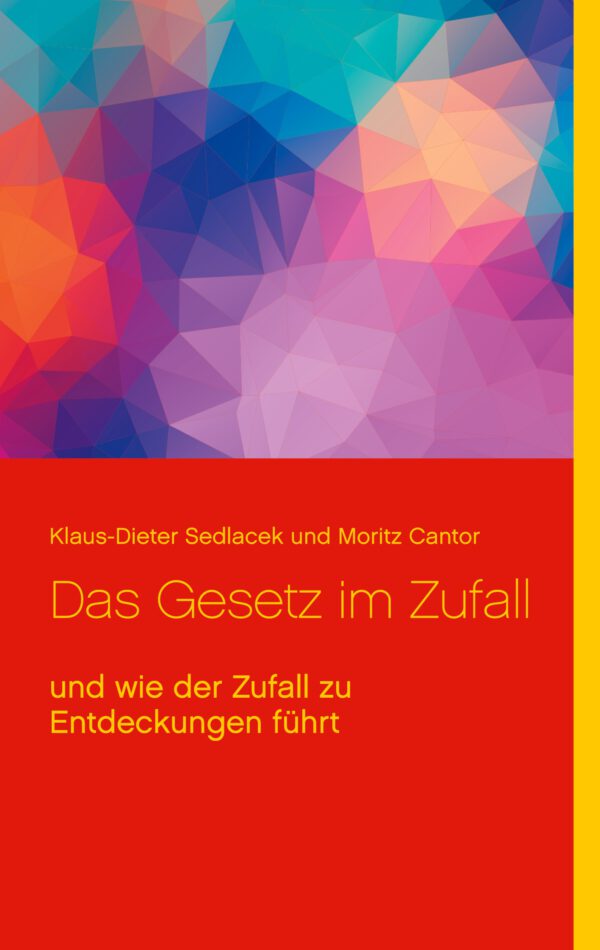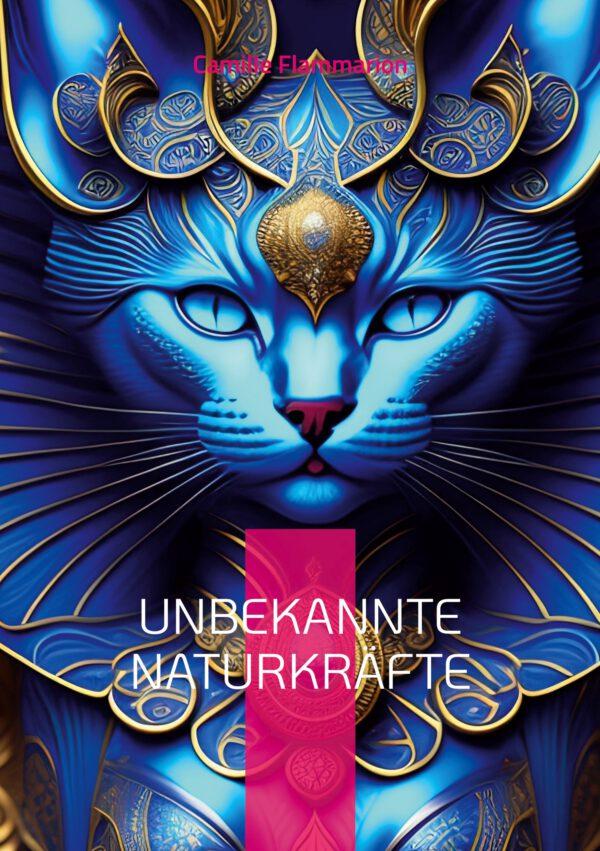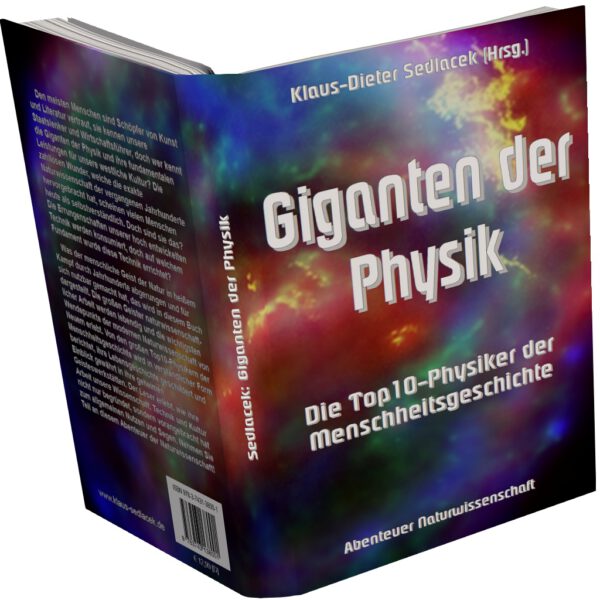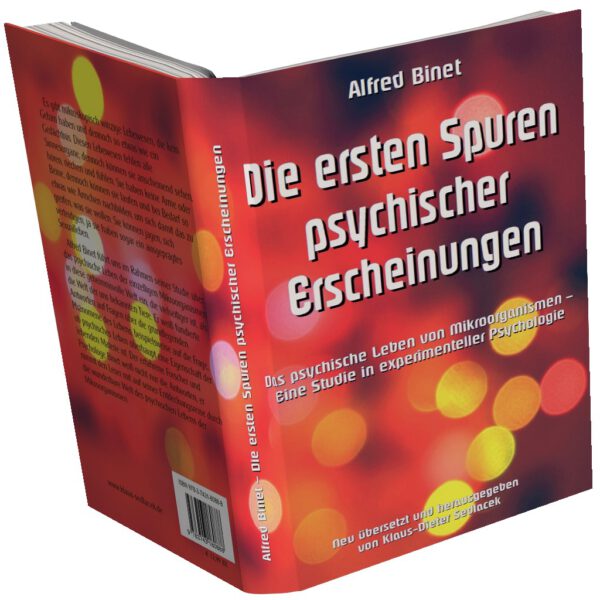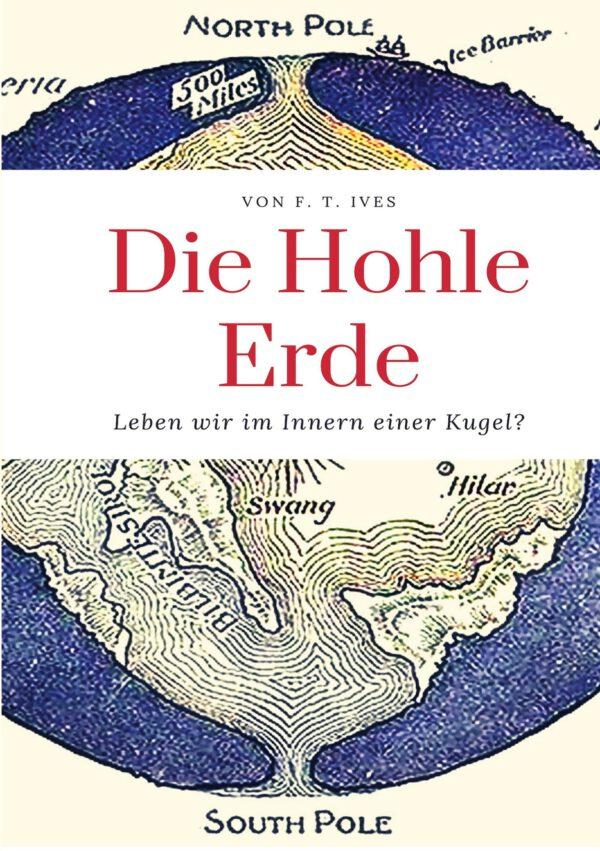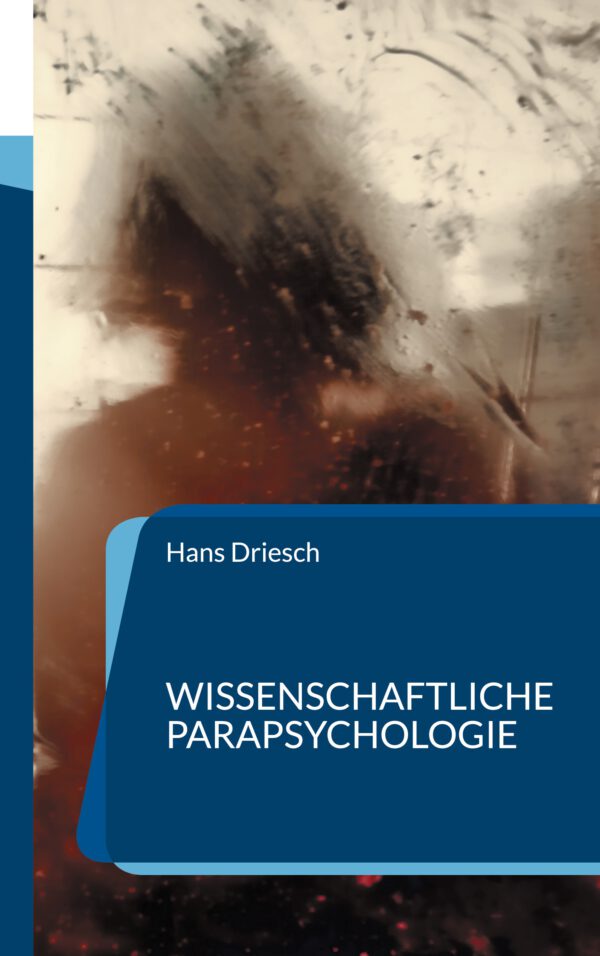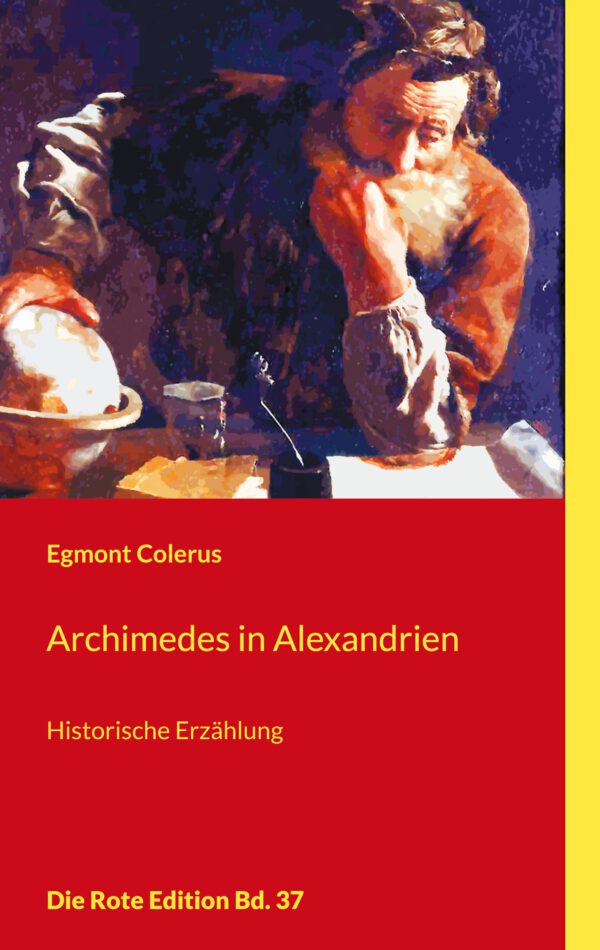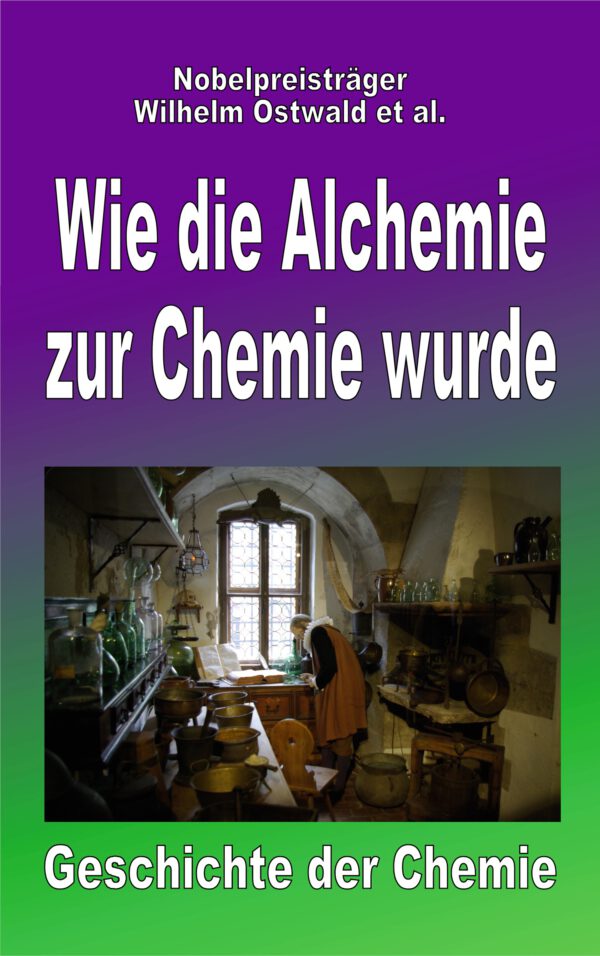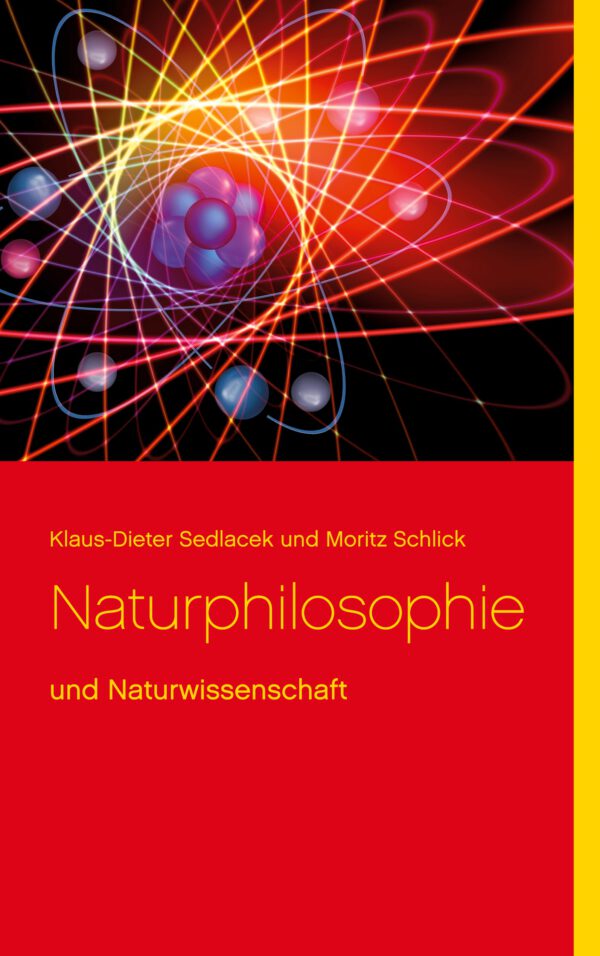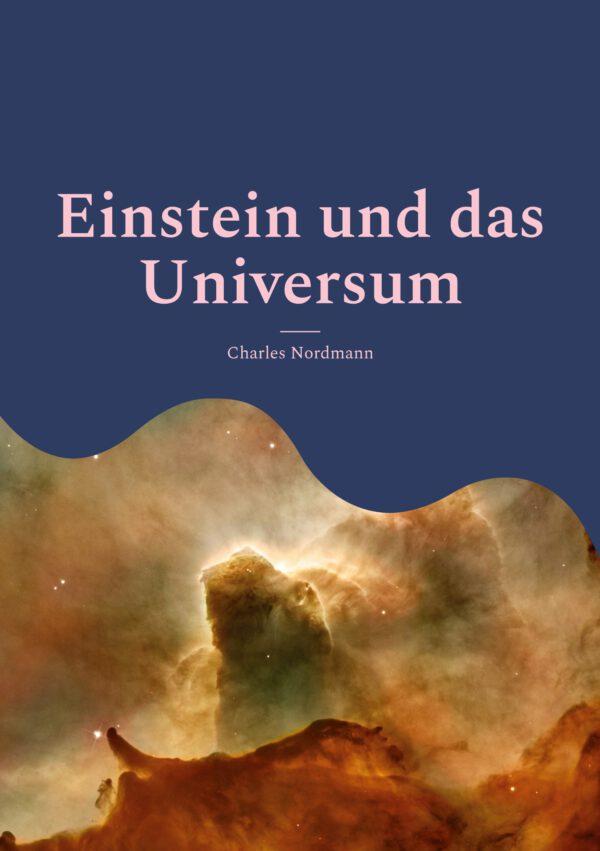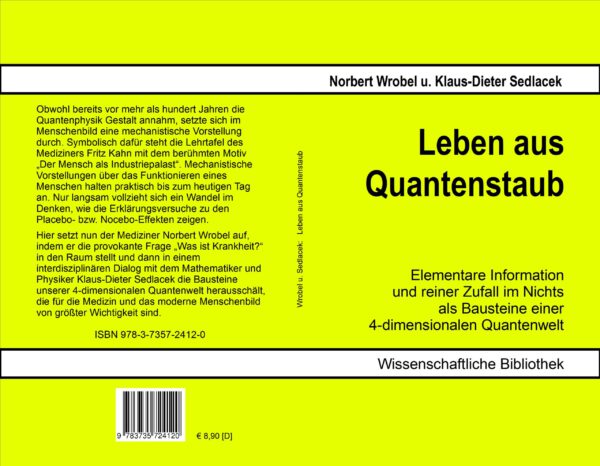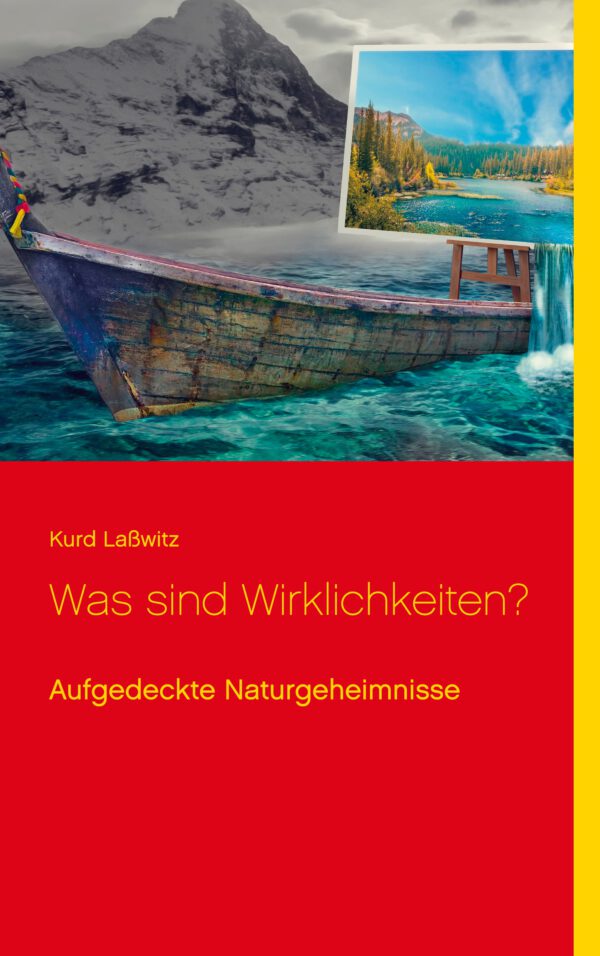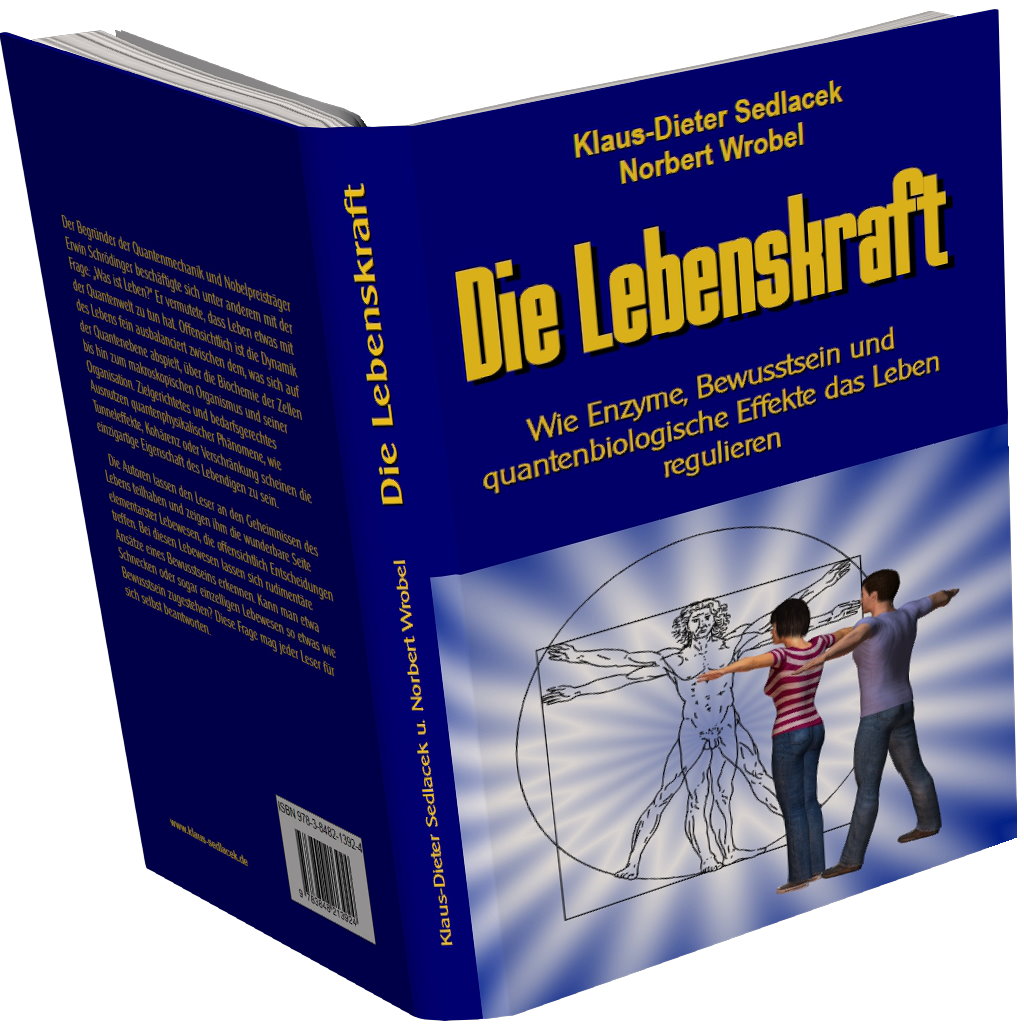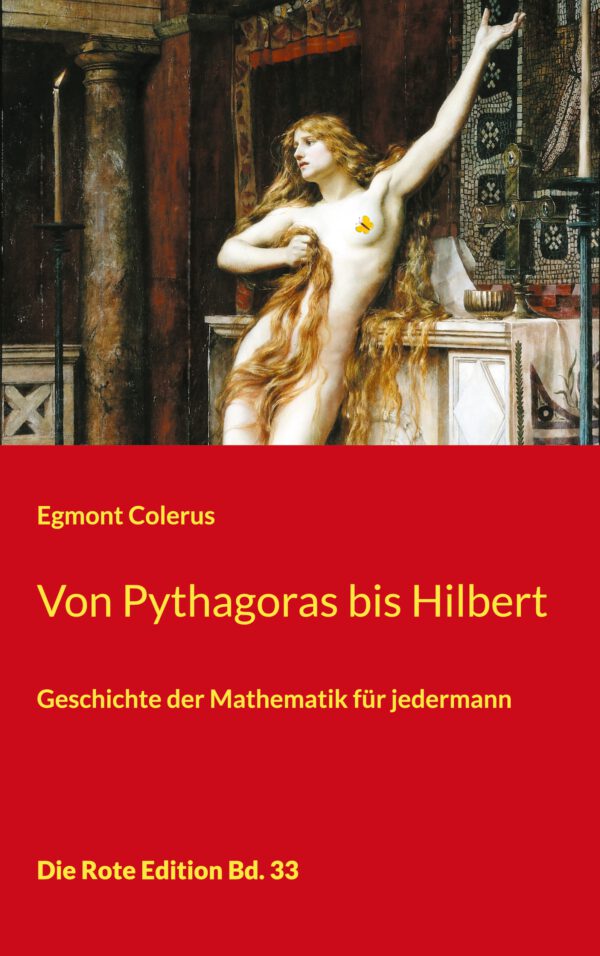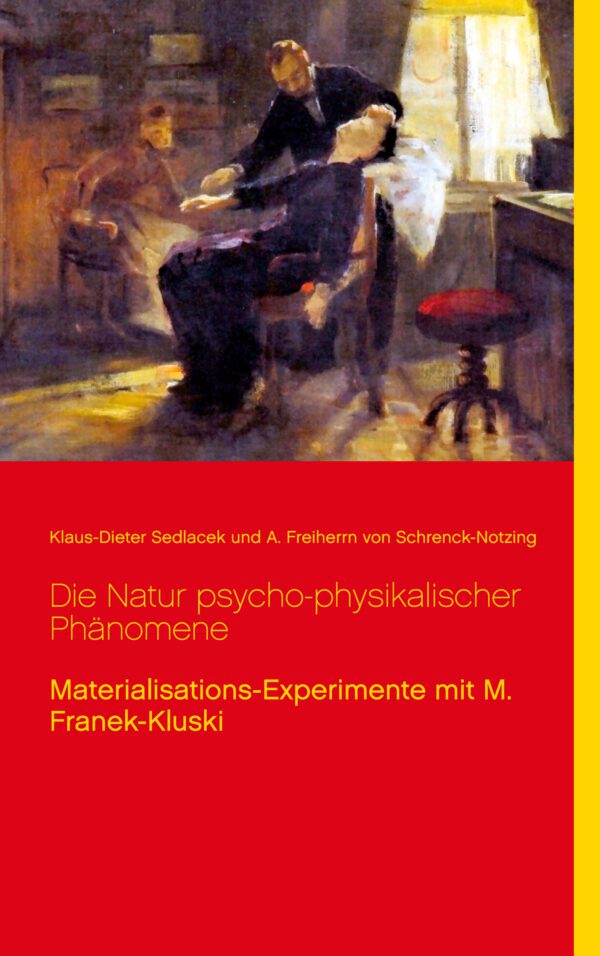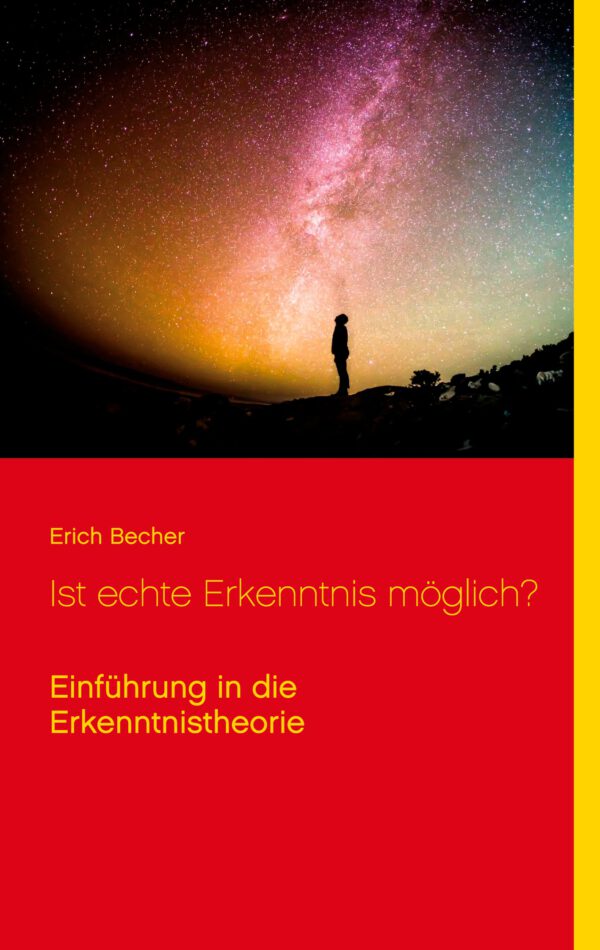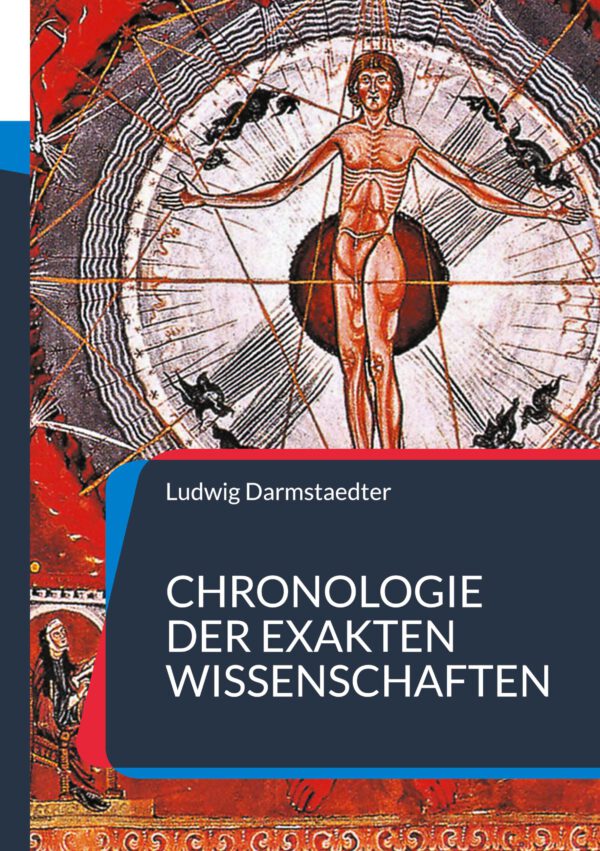01.08.2019 10:51
Wie sich Mikroorganismen gegen freie Radikale schützen
Charité-Forschende entdecken neuen Resistenzmechanismus
Mikroorganismen sind in den unterschiedlichsten Situationen freien Radikalen ausgesetzt, die wichtige Zellbausteine schädigen können. Freie Radikale entstehen beispielsweise im zellulären Stoffwechsel oder durch Umwelteinflüsse. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Krankheiten, der Arbeit des menschlichen Immunsystems und der Wirkung von Antibiotika. Eine Forschungsgruppe der Charité – Universitätsmedizin Berlin hat jetzt einen bisher unbekannten Mechanismus entdeckt, mit dem sich Mikroorganismen vor freien Radikalen schützen können. Dieses Wissen könnte dazu beitragen, die Wirkung antimikrobieller Substanzen zu verbessern. Die Forschungsergebnisse sind in der Fachzeitschrift Nature* publiziert.
Mit dem Begriff freie Sauerstoffradikale werden chemisch sehr reaktive Sauerstoffverbindungen bezeichnet, die eine Reihe von wichtigen Zellstrukturen wie Proteine, DNA und die Zellhülle schädigen können. Die zerstörerische Wirkung freier Radikale macht sich der menschliche Körper sogar zunutze: Einige Zellen seines Immunsystems bekämpfen eindringende Mikroorganismen, indem sie freie Radikale produzieren. Auch wenn mikrobielle Zellen mit Antibiotika in Kontakt kommen, entstehen durch die Stoffwechselaktivität reaktive Sauerstoffverbindungen. Um die hochreaktiven Moleküle abzufangen und unschädlich zu machen und so beispielsweise dem Angriff des Immunsystems zu entgehen, haben Mikroorganismen verschiedene Mechanismen entwickelt. Ein internationales Forschungsteam um Prof. Dr. Markus Ralser, Leiter des Instituts für Biochemie der Charité, konnte jetzt zeigen: Mikroorganismen haben eine weitere, bisher unbekannte Abwehrstrategie, die verglichen mit den bereits belegten Mechanismen besonders effektiv sein könnte.
Plötzlich gesund
Fortschreitende Naturerkenntnis, ganz allgemein gesprochen, ‘Wissenschaft’, ist der stärkste Feind des medizinischen Wunders. Was unseren Vorfahren als Wunder erschien, was einfache Naturvölker heute noch in heftige Erregung versetzt, das berührt den zivilisierten Menschen längst nicht mehr.
Doch es gibt einen Gegensatz, der jedem Denkenden sofort auffällt: der unerhörte, durchaus nicht abgeschlossene Aufstieg der wissenschaftlichen Heilkunde und die ebenso unerhörte Zunahme der Laienbehandlung und der Kurpfuscherei. Man schätzt die Zahl der Menschen, die der Schulmedizin kein Vertrauen schenken, auf immerhin 50 Prozent.
Wie kann es sein, daß Laienbehandler und Kurpfuscher immer wieder spektakuläre Erfolge aufweisen, von denen die Sensationspresse berichtet?
Der Autor geht dieser Frage nach und kommt zu interessanten Erkenntnissen, aus denen er Vorschläge für eine bessere Krankenbehandlung durch seine ärztlichen Standesgenossen ableitet.
Bei ihren Untersuchungen konzentrierten sich die Forschenden zunächst auf die Bäckerhefe als Modellorganismus. Sie konnten beobachten, dass die Hefezellen den molekularen Baustein Lysin für die Produktion von zelleigenen Eiweißstoffen aus der Umgebung aufnehmen und sehr stark anreichern – um ein 70- bis 100-Faches mehr als beim normalen Wachstum. Mittels mathematischer Modellierung und genetischen Analysen fanden sie dann heraus, wozu diese aktive „Lysin-Ernte“ dient: Die Zellen nutzen das Lysin, um ihren Stoffwechsel umzubauen. Als Konsequenz dieser Umstellung wird in außergewöhnlich großen Mengen das sogenannte Glutathion hergestellt – eines der wichtigsten Moleküle in lebenden Organismen, das Radikale abfängt. Tatsächlich zeigte sich, dass Hefezellen nach der „Lysin-Ernte“ deutlich resistenter gegenüber freien Radikalen waren. Mengen an freien Radikalen, die die Zellen normalerweise getötet hätten, konnten jetzt abgebaut werden. Wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nachwiesen, nutzen nicht nur verschiedene Arten von Hefen, sondern auch Bakterien diesen Resistenzmechanismus.
„Unsere Studie zeigt, dass Mikroorganismen Nährstoffe aus der Umgebung nicht nur für ihr Wachstum aufnehmen, sondern auch, um sich vorsorglich für einen möglichen Angriff freier Radikale zu rüsten“, erklärt Prof. Ralser. „Dieses Wissen könnten wir in Zukunft nutzen: Wenn es uns gelingt, den Resistenzmechanismus zu unterbrechen, ließe sich die Wirkung von antimikrobiellen Substanzen möglicherweise erhöhen.“ An diesem Ziel wird die Forschungsgruppe nun weiter arbeiten. „Außerdem werden wir nach weiteren unbekannten Resistenzmechanismen fahnden. Denn Voraussetzung für die Entwicklung neuer antimikrobieller Wirkstoffe ist es, die grundlegenden Prozesse in der Zelle zu verstehen.“
Informationen zur Studie
Prof. Dr. Markus Ralser ist seit Mai 2018 Einstein-Professor für Biochemie an der Charité. Der Experte für Stoffwechsel war zuvor am Francis Crick Institute in London sowie der University of Cambridge tätig. An beiden Einrichtungen arbeitete er mit seinen Teams an der vorgestellten Studie.
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Prof. Dr. Markus Ralser
Leiter des Instituts für Biochemie
Charité – Universitätsmedizin Berlin
t: +49 30 450 528 142
E-Mail: markus.ralser@charite.de
Originalpublikation:
*Olin-Sandoval V et al. Lysine harvesting is an antioxidant strategy and triggers underground polyamine metabolism. Nature. 2019 Jul 31. doi: 10.1038/s41586-019-1442-6
Weitere Informationen:
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1442-6
https://biochemie.charite.de/
Merkmale dieser Pressemitteilung:
Journalisten, Wissenschaftler, jedermann
Biologie, Chemie, Medizin
überregional
Forschungsergebnisse, Wissenschaftliche Publikationen
Deutsch